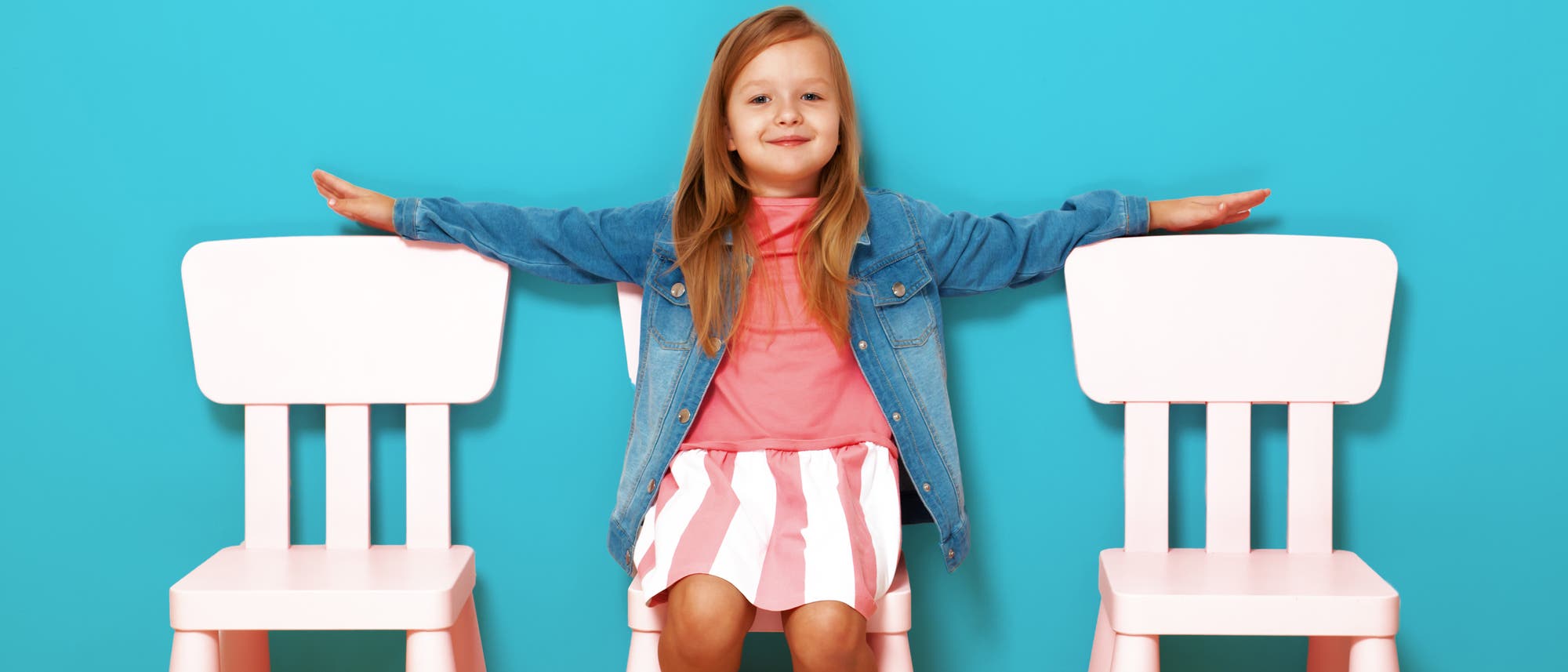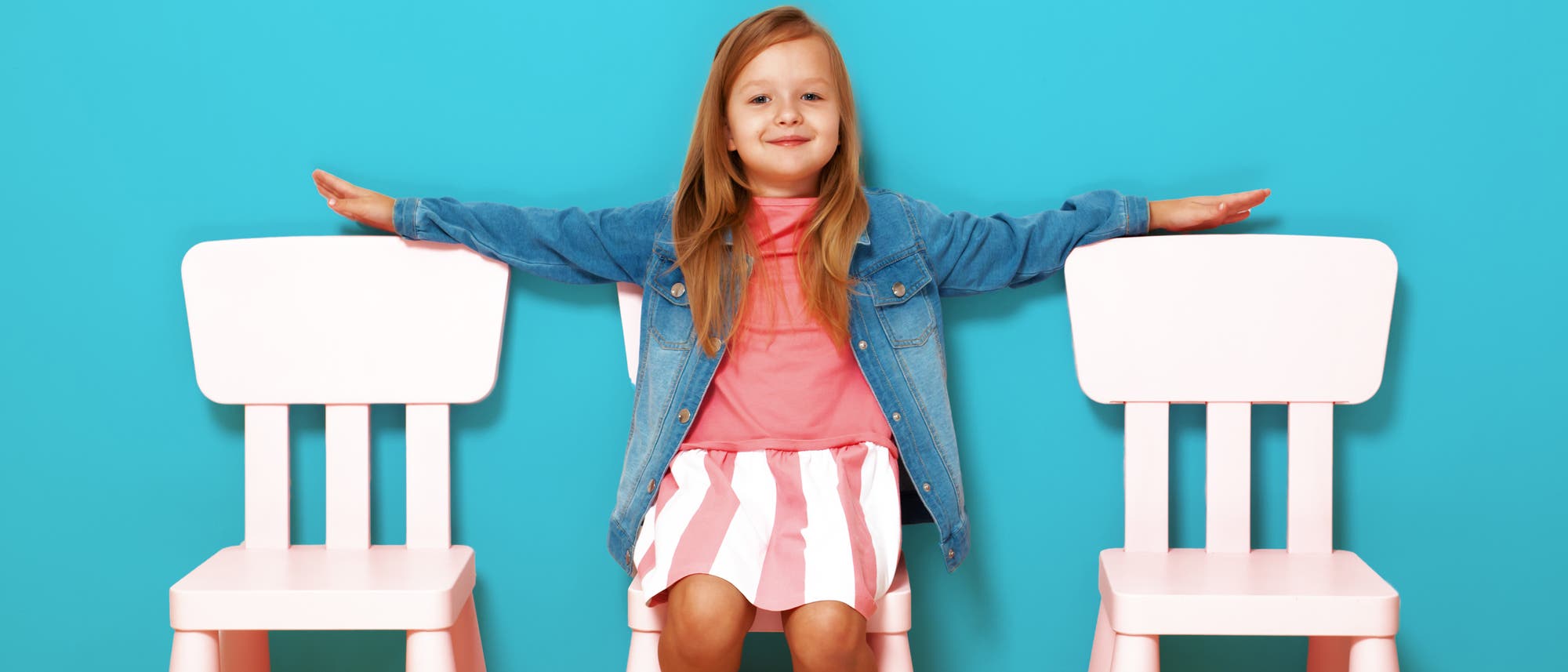
aus spektrum.de, 29. 1. 2022
Begriffe mit Familienähnlichkeit zu Philosophierungen
Was
haben »Call of Duty« und »Mein linker, linker Platz ist frei«
gemeinsam? Nicht viel? Warum bezeichnet man dann beide als Spiele? Ein
philosophischer Kniff hilft, das zu klären.
von Matthias Warkus
Spielen
Sie gerne? Oder zumindest ab und zu? Vermutlich ist die Antwort auf
diese Frage ja, wenn man sich zum Beispiel klarmacht, dass jeweils
deutlich über 30 Millionen Deutsche wenigstens ab und an Gesellschafts-
oder Computerspiele und über 20 Millionen zumindest gelegentlich Lotto
spielen. Und mit den über 13 Millionen minderjährigen Kindern spielen
vermutlich auch zig Millionen Erwachsene hin und wieder.
Eine Frage,
die naheliegt, wenn man eine solche Aufzählung liest, ist natürlich: Was
haben diese ganzen Spiele gemeinsam? Ist es sinnvoll, Call of Duty, die
Glücksspirale, Monopoly, Käsekästchen und »Mein linker, linker Platz
ist frei« in eine Schublade zu stecken? Philo-sophisch könnte man auch
fragen: Lassen sich all diese Freizeitbeschäftigungen auf einen
gemeinsamen, definierten Begriff »Spiel« bringen?
Die
traditionelle, so genannte hierarchische oder taxonomische Art des
Definierens von Begriffen geht mindestens bis auf Aristoteles zurück.
Sie arbeitet mit der Angabe von nächsthöherer Gattung (»genus proximum«)
und eigentümlichem Unterschied (spezifischer Differenz, »differentia
specifica«). Die nächsthöhere Gattung gibt eine Grundgesamtheit an, die
bereits bekannt ist. Der eigentümliche Unterschied ist eine Eigenschaft,
die innerhalb der Grundgesamtheit all jene Gegenstände gemeinsam haben,
die unter den Begriff fallen (und keine anderen).
So
lässt sich »Rechteck« definieren als Viereck (nächsthöhere Gattung),
bei dem alle Winkel rechte Winkel sind (eigentümlicher Unterschied). Es
ist durchaus möglich, dieselbe Menge von Individuen unter verschiedene
Definitionen zu bringen – ein Rechteck könnte man zum Beispiel auch als
ein Parallelogramm mit gleich langen Diagonalen definieren.
Etwas, dass alle Spiele eint, gibt es nicht
Das
Problem damit, eine solche Definition für den Begriff »Spiel« zu
finden, ist, dass sich zwar möglicherweise eine nächsthöhere Gattung
angeben lässt (etwa »Tätigkeit«), aber keine spezifische Differenz, denn
es gibt nichts, was alle Spiele gemeinsam haben. Call of Duty,
Monopoly, Käsekästchen und die Glücksspirale haben beispielsweise
gemeinsam, dass man in gewisser Weise gewinnen und verlieren kann; bei
»Mein linker, linker Platz ist frei« gibt es keine Gewinner oder
Verlierer. Man könnte vermuten, dass so etwas wie Regeln die
Gemeinsamkeit sind; aber viele Kinderspiele (etwa viele Rollenspiele
oder allein mit einem Flummi zu spielen) haben keine Regeln. Nicht alle
Spiele brauchen Spielmaterial, nicht alle brauchen mehrere Mitspieler,
es gibt wirklich nichts, was ihnen allen gemeinsam ist.
Wenn man
aber an Philosophie die gängige Forderung stellt, dass sie in der Lage
sein soll, unser alltägliches Reden und Handeln sauber zu fassen, dann
muss es doch auch möglich sein, zu sagen, wie der Begriff des Spiels zu
Stande kommt. Ein berühmter Vorschlag dafür kommt von Ludwig
Wittgenstein (in seinen »Philosophischen Untersuchungen«, die 1953
postum erschienen). Er argumentiert, dass bei Begriffen wie »Spiel«
(oder auch »Sprache«) nicht alle darunter fallenden Individuen eine
gemeinsame Eigenschaft haben, sondern dass jeweils nur Teilmengen
gemeinsame Eigenschaften haben und untereinander durch Überschneidung in
Verbindung stehen. Eine Metapher, die Wittgenstein dafür nennt, ist die
eines Fadens, in dem keine Faser auf ganzer Länge durchläuft, der aber
dennoch zusammenhält, da sich die Fasern untereinander überlappen.
 Spektrum Kompakt: Was ist real? – Am Übergang von Wissenschaft und Philosophie
Spektrum Kompakt: Was ist real? – Am Übergang von Wissenschaft und Philosophie
Ist man bereit, Begriffe auf Basis von Familienähnlichkeit zu
akzeptieren, muss man damit leben, dass diese sich nicht griffig und
völlig »trennscharf« definieren lassen, sondern stets nur
näherungsweise. Man gewinnt damit aber die Möglichkeit, philosophisch
über komplexe und bedeutsame Phänomene unserer Welt und unseres
täglichen Lebens zu reden, die sich auf traditionelle Weise gar nicht
fassen lassen. Neben Spiel und Sprache sind andere Phänomene, die sich
vermutlich am besten über Familienähnlichkeiten umschreiben lassen, etwa
Jazz oder Design: Es gibt keine Eigenschaft, die alle Jazzmusikstücke –
und nur diese – gemeinsam haben, genauso wenig, wie dies bei allen
Designobjekten der Fall ist. Aber es lassen sich verschiedene Aspekte,
die von vielen Individuen im jeweiligen Begriffsfeld geteilt werden,
angeben, die zusammen ein ziemlich genaues »Familienporträt« ergeben.
Nota. - Herr Warkus, das ist ärgerlich. Zum ersten: Was Sie eine Familienähnliuchkeit nen-nen, ist lediglich ein Begriff, der noch nicht (wieder) so genau bestimmt ist, wie es die Er-fordernisse des Verkehrs (inzwischen) erheischen. Der Stoff, aus dem Begriffe gemacht werden, sind Vorstellungen, die im Verkehr prozessierend wechselbestimmt werden - näm-lich von einem Moment zum andern; nämlich jeweils zwischen denen, die im Moment mit-einander verkehren. "Es gibt" den Begriff nicht, sondern er wird benutzt, mal so, mal so.
Zweitens ist das Spiel ein völlig ungeeignetes Beispiel. Es lässt sich allerdings definieren, sofern man nämlich will, was aber selten der Fall ist, weil Zweideutigkeit meistens beabsich-tigt war: Spiel ist eine zweckmäßige Tätigkeit, deren Zweck jedoch unbestimmt ist - nicht bloß 'an sich', sondern absichtsvoll: "experimentieren mit dem Zufall". Aber so hätte Witt-genstein das Spiel gar nicht definieren dürfen - oder hätte auf sein "Sprachspiel" verzichten müssen! Dessen Zweck ist natürlich nicht 'absichtlich offen', sondern ist Verständigung. Die schlichteste Form des Spiels ist Kopf oder Zahl: eins von beiden. Klappt oder klappt nicht, verständigt oder nicht, ist schon kein Spiel mehr, sondern Gelingen oder Scheitern. Das Spiel dagegen kann nicht scheitern.
Und zu allem Überfluss, Herr Warkus, muss ein Spiel keineswegs eine Freizeitbeschäftigung sein.
JE
 zu Wissenschaftslehre - die fast vollendete Vernunftkritik
zu Wissenschaftslehre - die fast vollendete Vernunftkritik