Unser etwas anderes Gehirn
Der Mensch tickt wirklich anders
Unser Gehirn ist besonders, und das ist nicht nur eine Frage der Größe. Auf der Suche nach der Einzigartigkeit finden Hirnforscher immer mehr spannende Details. Was Roboterentwickler wissen sollten.
Von Joachim Müller-Jung
D as Gehirn des Menschen imitieren – formuliert ist dieses Ziel schnell. Zumal in einer Welt, die sich ungeduldig nach Durchbrüchen, technologischen Vorsprüngen und Wettbewerbsvorteilen sehnt. Doch wie nah dran sind sie wirklich, die Programmierer, Biotechniker und Neuroingenieure, die sich in ihren Milliarden Dollar schweren Hightech-Hubs mit dem komplexesten Apparat abmühen, den die Evolution hervorgebracht hat? Man könnte es kurz machen: weit weg noch. Glaubt keinem, der das menschliche Gehirn zu simulieren verspricht. Allerdings lohnt es sich sehr wohl, nach den Gründen zu suchen. Denn die Versuche scheitern bisher nicht etwa an technischen Defiziten, sondern ganz einfach daran, dass die Neurowissenschaften überhaupt erst allmählich begreifen, wenn auch mit immer raffinierteren Methoden, was das Besondere am menschlichen Gehirn ist. Wohlgemerkt: Am Gehirn, den Geist klammern wir erst mal geflissentlich aus.
Woher sollten wir auch wissen, was die prähistorischen Vorläufer des Menschen gedacht haben, welche geistigen Potentiale der Informationsverarbeitung im Gehirn – Kognition – von Australopithecus, Homo erectus oder Neandertaler schlummerten? Klar ist: Die Gehirne der Primaten haben vor einigen Millionen Jahren begonnen, sich auseinanderzuentwickeln. Vor allem das Größenwachstum – das augenfälligste Unterscheidungsmerkmal in der Abstammungslinie hin zum modernen Menschen – zeigt bemerkenswerte Entwicklungen. Unser Gehirn ist mit seinen 1,3 bis 1,5 Liter Volumen dreimal so groß wie das der nächsten Verwandten, Schimpansen und Bonobos. Aber es ist keineswegs größer als das des Neandertalers, der vor Hunderttausenden Jahren lebte und vor gut 40.000 Jahren ausgestorben* ist.
Größe allein ist nicht entscheidend. Auch die Zahl der Falten und Furchen ist es nicht. Wieland Huttner und seine Kollegen am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden haben sich die Gehirne von mehr als hundert Säugetierarten angesehen. Vielen wie Mäusen und Makis fehlen die Faltungen, die zur Vergrößerung der Hirnoberfläche führen, andere wie Delphine und Elefanten haben sie, und sie haben noch dazu größere Gehirne – dennoch fehlen ihnen viele der als typisch menschlich identifizierten kognitiven Fähigkeiten, angefangen von der komplexen Sprache bis zum abstrakten Denken, das unsere zahlreichen Kulturtechniken hervorgebracht hat.
Interessanter
werden die Größenvergleiche, wenn man in ganz spezielle Bereiche geht,
vor allem in die Großhirnrinde, lange auch als Kortex bekannt. Etwa 16
Milliarden Zellen zählt sie beim Menschen. Sie ist etwa drei Millimeter
dick, grau, und sie umgibt die darunter liegende weiße Hirnmasse.
Stammesgeschichtlich ist sie zuletzt entstanden, quasi am äußersten Ende
des Zentralnervensystems, dem Endhirn oder Telencephalon.

Pyramidalzellen aus der Hirnrinde sind nicht nur architektonisch besonders, sie sind auch elektrophysiologisch offenbar anders.

Pyramidalzellen aus der Hirnrinde sind nicht nur architektonisch besonders, sie sind auch elektrophysiologisch offenbar anders.
Die Aufmerksamkeit
richtet sich dabei besonders auf die Hirnrinde, und zwar sowohl, was die
Architektur angeht, als auch die Arbeitsweise. Menschenaffen haben
deutlich weniger Nervenzellen in der Hirnrinde, auch beim Neandertaler
war mindestens der vordere Teil, der frontale Kortex, kleiner. Und es
ist nicht nur die Zahl, auch die Vielfalt ist beim Homo sapiens
ungewöhnlich: Es gibt große, viel stärker verzweigte Pyramidenzellen,
die die Hirnrinde durchmessen, Dopamin produzierende Interneurone, aber
auch außergewöhnlich viele, vergleichsweise große Astrozyten und
Oligodendrozyten – jede Zellart scheint irgendwie zu helfen, die Arbeit
der Hirnrinde zu optimieren, wo die Netzwerke für Wahrnehmung, Lernen,
Emotionen und Gedächtnis zusammenlaufen.
Max-Planck-Hirnforscher Huttner, dessen Team seit einiger Zeit zusammen mit den evolutionären Anthropologen um Svante Pääbo in Leipzig die Ursachen für diese Hirnrinden-Vergrößerungen in unserer Stammeslinie untersucht, hat jüngst in „Science“ eine möglicherweise entscheidende, tiefer liegende Quelle lokalisiert. Das Gen mit der Bezeichnung ARHGAP11B, an dem Huttner seit langem arbeitet, liegt in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen. Eine einzige, winzige Punktmutation in dieser Erbanlage hat beim Menschen offenbar dazu geführt, dass die Stammzellen, die das Zellmaterial für die Hirnrinde liefern, überaktiv sind. Das führt dazu, dass der Mensch zwei- bis dreimal so viele Nervenzellen im Kortex ausbildet wie etwa Gorillas oder Orang-Utans. Baut man die menschliche Genvariante ins Erbgut von Mäusen ein, vergrößert sich deren Hirnrinde – und kann sich plötzlich sogar falten.
Max-Planck-Hirnforscher Huttner, dessen Team seit einiger Zeit zusammen mit den evolutionären Anthropologen um Svante Pääbo in Leipzig die Ursachen für diese Hirnrinden-Vergrößerungen in unserer Stammeslinie untersucht, hat jüngst in „Science“ eine möglicherweise entscheidende, tiefer liegende Quelle lokalisiert. Das Gen mit der Bezeichnung ARHGAP11B, an dem Huttner seit langem arbeitet, liegt in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen. Eine einzige, winzige Punktmutation in dieser Erbanlage hat beim Menschen offenbar dazu geführt, dass die Stammzellen, die das Zellmaterial für die Hirnrinde liefern, überaktiv sind. Das führt dazu, dass der Mensch zwei- bis dreimal so viele Nervenzellen im Kortex ausbildet wie etwa Gorillas oder Orang-Utans. Baut man die menschliche Genvariante ins Erbgut von Mäusen ein, vergrößert sich deren Hirnrinde – und kann sich plötzlich sogar falten.
Ein Gen, das Falten macht
Die Mutation des Gens steigert den
Stoffwechsel, die sogenannte Glutaminolyse. Den Stammzellen steht damit
mehr chemische Energie zur Vermehrung zur Verfügung. Ausgerechnet
wuchernde Krebszellen nutzen ebenfalls diesen Prozess. Freilich wird er
in der Hirnentwicklung offenkundig kontrolliert eingesetzt – was
allerdings wohl auch seinen Preis hat: Jedenfalls nimmt die frühe
Vermehrung und Reifung der Hirnrindenzellen zusätzlich Zeit in Anspruch –
ein möglicherweise entscheidender Grund, so Huttner, weshalb die
Schwangerschaft bei Schimpansen, denen die Mutation fehlt, schon nach
237 Tagen, die des Menschen aber erst nach 280 Tagen abgeschlossen ist.
Hinweise, dass
die Hirnentwicklung beim Menschen verzögert abläuft, haben auch Barbara
Treutlein und ihre Kollegen am Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie in Leipzig gefunden. Sie arbeiten wie inzwischen viele
Neurobiologen mit „Minihirnen“, sogenannten Organoiden, die in der
Petrischale erzeugt werden. Mittlerweile lässt sich das Gewebe aus
einzelnen Hirngeweben wie eben dem frontalen Kortex künstlich im Labor
aus Stammzellen züchten. Treutlein und ihr Team haben vor kurzem in
„Nature“ berichtet, wie sie die Genaktivität in Organoiden aus
menschlichem Gewebe mit dem von Schimpansen und Makaken verglichen
haben. Resultat: Die Aktivitätsmuster der Hirnzellen unterscheiden sich
fundamental. Menschliche Hirnzellen reifen offenbar tatsächlich
langsamer. Zudem gibt es offenbar einige Gene, die ausschließlich im
menschlichen Kortex in Aktion treten.
Einzigartige Aktionspotentiale in der Hirnrinde
Welche aber sind das, und erklärt das
wirklich die Ausnahmestellung des menschlichen Gehirns? Dass noch Lücken
zu füllen sind, um unsere kognitive Sonderstellung zu erklären, zeigen
auch die Arbeiten von Albert Gidon von der Humboldt-Universität Berlin
und seinen Kollegen am Epilepsie-Zentrum Berlin-Brandenburg und an der
Charité. Die Forscher haben jüngst in „Science“ eine bemerkenswerte
Entdeckung präsentiert. Mit neuen Methoden, mit denen sie Hirngewebe aus
dem Kortex von Epilepsie- und Tumorpatienten extrem detailliert
untersuchen und einzelne Verästelungen an den Nervenzellen – Dendriten –
vermessen können, haben die Wissenschaftler völlig überraschende
Eigenschaften entdeckt: „dendritische Kalzium-Aktionspotentiale“.
Dabei handelt es sich um elektrische Signale, die offensichtlich nur in den Dendriten menschlicher Pyramidenzellen zu finden sind. Lange dachte man, die unzähligen Dendriten leiten die Nervenimpulse einfach allesamt weiter zum Zellkörper des Neurons – wo die vielen anregenden und hemmenden Signale miteinander verrechnet werden. Entscheidend sei allein, wie eng das Netzwerk dieser Synapsen-Verbindungen geknüpft ist, an denen die Signale ausgetauscht werden. Nun ist klar: Auch die Abermillionen „Arme“ dieser Nervenzellen selbst, die Dendriten, können bereits die Signalstärken miteinander verrechnen. Die Nervenzelle ist also nicht nur Teil eines großen modular aufgebauten Netzwerks, sie besitzt auch für sich schon massive Computerpower. Solche Pyramidenzellen fanden die Forscher bisher nur in den Hirnrindenschichten L2 und L3, und die sind offensichtlich ein Exklusivmerkmal des Menschen.
Dabei handelt es sich um elektrische Signale, die offensichtlich nur in den Dendriten menschlicher Pyramidenzellen zu finden sind. Lange dachte man, die unzähligen Dendriten leiten die Nervenimpulse einfach allesamt weiter zum Zellkörper des Neurons – wo die vielen anregenden und hemmenden Signale miteinander verrechnet werden. Entscheidend sei allein, wie eng das Netzwerk dieser Synapsen-Verbindungen geknüpft ist, an denen die Signale ausgetauscht werden. Nun ist klar: Auch die Abermillionen „Arme“ dieser Nervenzellen selbst, die Dendriten, können bereits die Signalstärken miteinander verrechnen. Die Nervenzelle ist also nicht nur Teil eines großen modular aufgebauten Netzwerks, sie besitzt auch für sich schon massive Computerpower. Solche Pyramidenzellen fanden die Forscher bisher nur in den Hirnrindenschichten L2 und L3, und die sind offensichtlich ein Exklusivmerkmal des Menschen.
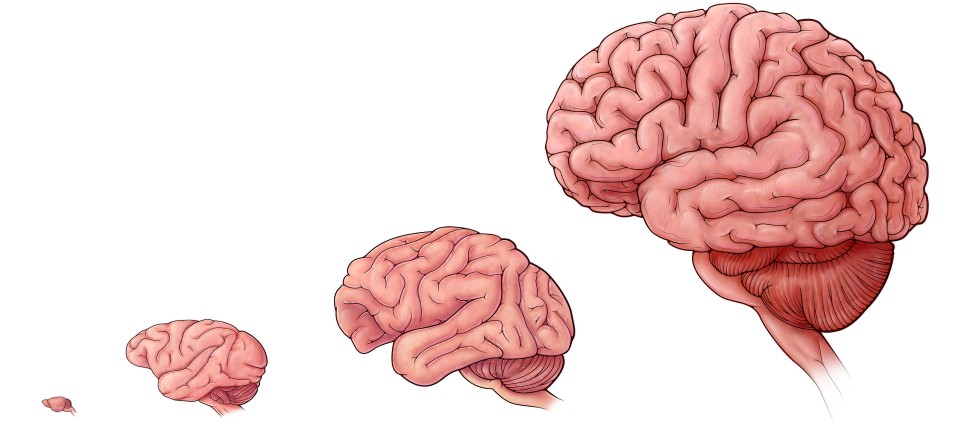
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen