
aus spektrum.de, 2. 6. 2022
Rezension zu Philosophierungen
»Wetter, Viren und Wahrscheinlichkeit«
Mit Zahlen gegen den Zufall
Ian Stewart lässt Ungewissheiten mit Hilfe der Mathematik gar nicht mehr so ganz ungewiss erscheinen. Eine Rezension
von Thorsten Naeser
Kein Wunder, dass der Autor so denkt. Stewart ist einer der bekanntesten Professoren für Mathematik in Großbritannien und damit sicher ein extrem rational denkender Zeitgenosse. Das wird schnell deutlich, wenn man sein neues Buch zur Hand nimmt. Vor Zahlenreihen, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen sollte man nicht zurückschrecken: Sie sind elementarer Bestandteil der Lektüre. Wer sich im Reich der Zahlen wohlfühlt, ist nicht schlecht aufgehoben, wenn der Autor erklärt, wie Ungewissheiten mathematisch betrachtet gar nicht mehr so ungewiss erscheinen – und warum berechnete Vorhersagen durchaus eine hohe Chance haben, einzutreffen.
Als eines der ersten Beispiele führt Stewart
das Auftreten von Seuchen und Pandemien an. Kein Wunder, entstand das
Buch teilweise zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie. Noch vor wenigen
Jahrhunderten galten solche Katastrophen als zufällige Naturereignisse.
Doch Fortschritte auf verschiedenen Gebieten – und Mathematik spielt
dabei eine wichtige Rolle – hat uns Werkzeuge an die Hand gegeben, viele
der schlimmsten Auswirkungen abzumildern, davon ist Stewart überzeugt.
Wie die Mathematik der Medizin dient, erläutert er in einem eigenen
Kapitel. Die aktuelle Covid-Pandemie thematisiert er darin aber nicht,
stattdessen geht es unter anderem um Wahrscheinlichkeiten
abgeschlossener Studien zum Thema Brustkrebs oder die Einnahme von
Antidepressiva.
Von Pandemien über das Wetter zu den Quanten
Neben
der Medizin kommen im Buch viele weitere Themen zur Sprache, bei denen
die Mathematik Unwägbarkeiten abzufedern vermag. Etwa in der
Wetterforschung, die sicher zu den schwierigsten Disziplinen gehört,
wenn es darum geht, verlässliche Prognosen abzugeben. Zur Sprache kommt
dabei auch die berühmte Frage, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings
in Brasilien wirklich einen Sturm in Texas auslösen kann.
Spannend wird es auch gegen Ende, wenn es um die Mutter aller Zufallsereignisse, die Quantenungewissheit, geht. Die Quantenphysik lehrt uns, dass im Kosmos alles zufällig passiert. Vorhersagen werden schon im Ansatz vaporisiert. Auch Stewart bezweifelt, dass sich die Quantenungewissheit jemals ausräumen lassen wird, glaubt aber dennoch, dass es eine deterministische Erklärung dafür geben könnte.
Meist sieht der
Autor die Ungewissheit als Problem, das den Blick in die Zukunft
verwehrt. Doch Ungewissheiten können auch von Nutzen sein, schreibt er.
Der unmittelbarste Nutzen trete bei der Lösung mathematischer Probleme
auf. So kann man etwa in so genannten Monte-Carlo-Simulationen Lösungen
aus vielen Probesimulationen von Ungewissheiten ableiten.  Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: Logik
Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: Logik
Nach der Lektüre bleibt zumindest eine Gewissheit: Trotz aller Mathematik, Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnungen wird unser Leben weiterhin von Zufällen und Unwägbarkeiten geprägt bleiben. Nicht zuletzt machen sie unser Dasein spannend und auch ein bisschen lebenswert. Die Zukunft ist ungewiss, das erkennt auch Stewart am Ende des Buchs an. Für ihn aber ist die Wissenschaft der Zukunft die Wissenschaft von der Ungewissheit.
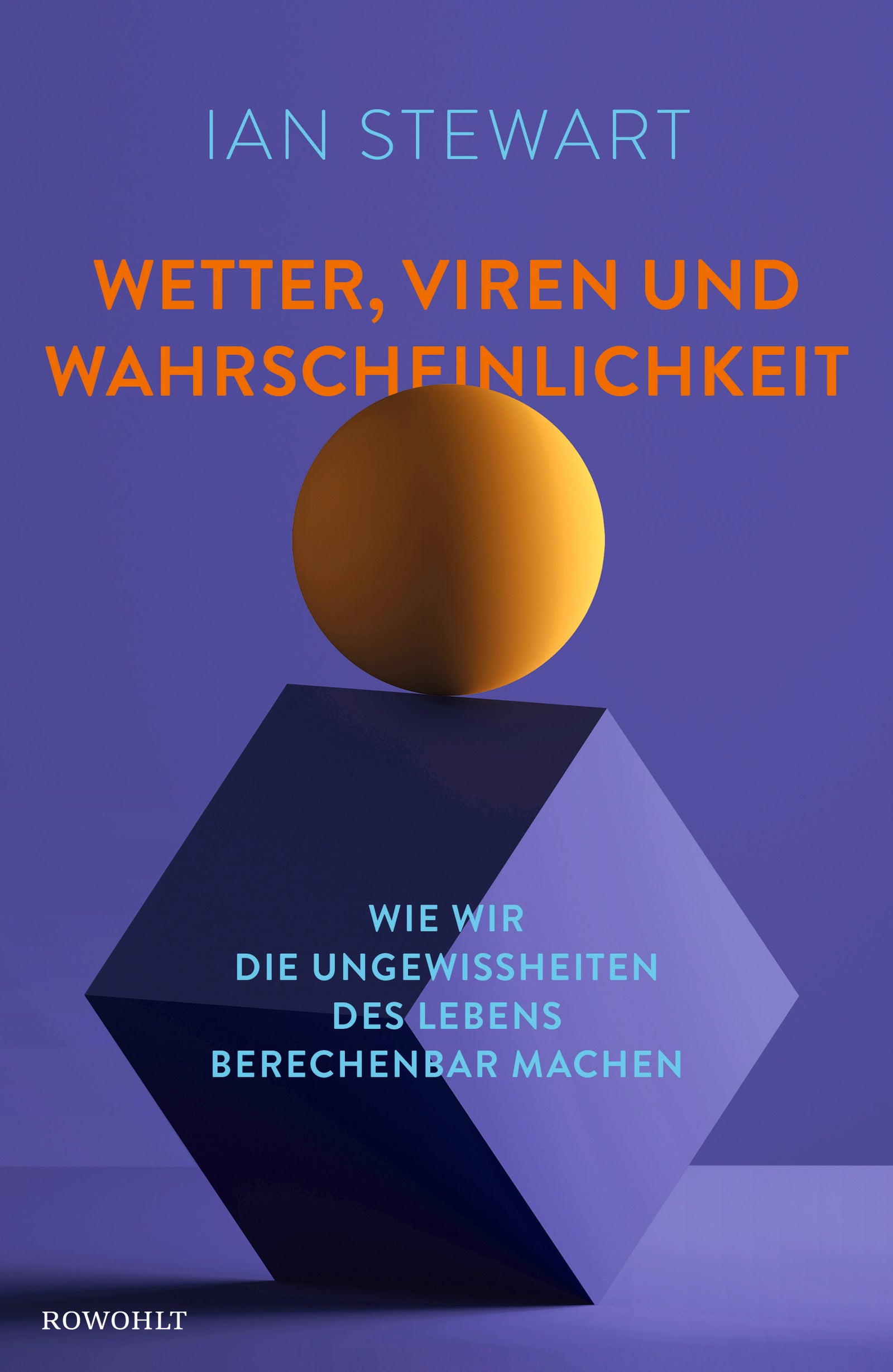
Ian Stewart
Wie wir die Ungewissheiten des Lebens berechenbar machen
Verlag: Rowohlt, Hamburg 2022
ISBN: 9783498001346 | Preis: 22,00 €
Nota. - Ist Ungewissheit der Preis der Intelligenz? Umgekehrt. Intelligenz ist der Lohn der Ungewissheit. Wären wir nicht aus der verbürgten Nische des angestammten ostafrikani-schen Urwalds in eine offene Savanne ausgebrochen und dort auf lauter Unvorhersehbares gestoßen, hätten wir Intelligenz nie gebraucht - und uns nie einfallen lassen.
Wir haben jetzt die
Frage zu beantworten: Wie kommt man zu obiger Frage? Und was tut man,
indem man diese Frage nur streift? Die Frage nach dem Grunde gehört
selbst zu den notwendigen Vorstellungen.
Man sucht nur den Grund
von zufälligen Dingen. Die Philosophie überhaupt sucht den Grund von
notwen- digen Vorstellungen; diese müssen also als zufällig gedacht
werden.
Es wäre Unsinn, nach
dem Grund eines Dinges zu fragen, das ich nicht für zufällig hielte. Ich
halte etwas für zufällig heißt: Ich könnte denken, dass es gar nicht
oder dass es ganz anders wäre. So sind die Vorstellungen vom ganzen
Weltsystem; wir denken uns die Erde füglich als anders sein könnend, und
uns selbst können wir auf einen andren Planeten versetzt denken. Ob wir
ohne solche Vorstellungen sein könnten, belehrt uns die Philosophie;
aber dass wir das Weltsystem für zufällig halten, ist gewiss, denn nur
darum können wir nach einem Grund fragen.
Dieses Faktum enthält
die ganze Erfahrung; aus dieser geht man heraus, mithin auch aus der
gesamten Erfahrung heraus, und dies ist Philosophie und nichts anderes.
_________________________________________________________________
J. G. Fichte, Wissenschaftslehre nova methodo, II. Einleitung, Hamburg 1982, S. 13
Nota I. - Der
gesunde Menschenverstand sieht das ganz anders. Was zufällig ge-schieht,
scheint ihm nicht hinreichend begründet, und was hinreichend begründet
ist, kann eigentlich gar nicht anders sein. - Doch der gesunde
Menschenverstand ist ein Metaphysiker, für ihn sind logische Gründe und reelle Ursachen dasselbe. Aber not-wendig ist nur das Logische, alles
Faktische ist nur mehr oder minder wahrscheinlich, und also mehr oder
minder kontingent. Für das metaphysische Denken sind indessen beides
'Kräfte' aus einem 'Stoff', denen ein und dieselbe Substanz 'zu Grunde
liegt'. Und die stellen sie sich unweigerlich als einen Schöpfer vor - der selber aber 'ganz anders' hätte schöpfen können!
Die kritische
Philosophie macht es möglich und recht eigentlich notwendig, sich das
bloß Seiende, das lediglich ist, weil es ist, als einen Zufall
vorzustellen. Erst dann kann und muss man immer fragen: warum? Und keine
Antwort kann je die letzte sein, man muss immer weiter fragen: warum
nun aber dies? Einen Anfang wird man nie finden, man müsste ihn schon postulieren. Doch auch nur die Kritische Philoso-phie erlaubt, einen Akt der Freiheit zu denken.
10. 6. 16
Nota II. - Nein: Der gesunde Menschenverstand glaubt gar nicht an den Zufall. Ver-stand, nämlich kein Aberglaube, ist er eben wegen
seiner Gewissheit des Gesetzes von Ursache und Wirkung. Wenn eine
Usache nicht offenkundig ist, nimmt er eine an, die so vielfältig
vermittelt ist, dass sie ihn - den gesunden Menschverstand - übersteigt. Chaostheorie versteht er vielleicht nicht, aber er glaubt
sie gern. Die Vor-stellung, dass etwas einfach nur so ist, wie es eben
ist, und keinen hinreichenden Grund dafür hat, ist ihm gar nicht möglich
- so wenig wie dem Aberglauben: Auch der nimmt immer eine Ursache an,
und gern auch eine okkulte.
Genauer gesagt, einen
Verursacher. Den hat auch im Vernunftzeitalter noch das Kirchendogma
verbürgt, im Deismus der Aufklärer wurde er lediglich aus der Welt
heraus vor deren Anfang versetzt, als Uhrmacher und Anstoßgeber.
Fichte schrieb schon in der Epoche der Naturgesetze. Auch hinter denen steht die Annahme von einem, der gesetzt hat. Für die hinreichende Ursache ist a priori ge-sorgt; auch dann noch, wenn ich mir das Naturgesetz ohne gesetzgebenden Schöp-fer als unerschaffene, von sich aus wirkende Kraft vorstelle (die dann freilich selber ohne Grund wäre). Zufällig ist nun das, was nicht offenkundig unters Naturgesetz fällt; das bedarf einer Begrün-dung. So etwa die Welt, die schon war, bevor ein Ge-setz in ihr wirken konnte.
*
Fichte geht es hier um die notwendigen Vorstellungen und den ganzen Komplex der Denknotwendigkeit. Es gibt ein Denken, das uns als notwendig vorkommt. Um das erklären zu können, müssen wir es im Gegenteil als zufällig denken: so, als ob es auch anders sein könnte. Da sagt er mehr, als er sich ausdrücklich zu formulieren wagt: Es muss selber aus Freiheit notwendig geworden sein; aus Freiheit notwendig. Das ist der einzige Grund, der selber keinen hat und daher in unserer Welt von Ursachen und Wirkungen als Zufall erscheint. Aber auch nur, weil er in unserer Welt gar nicht stattgefunden hat, sondern in der Vorstellung, und in unserer Welt erst wirklich wirkt, wenn er sich zu einem Ich bestimmt und Zwecke gesetzt hat.
JE, 4. 10. 18

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen