 aus spektrum.de, 3. 1. 2022 Rembrandt, Anatomie des Dr. Tulp zuJochen Ebmeiers Realien; zu Philosophierungen
aus spektrum.de, 3. 1. 2022 Rembrandt, Anatomie des Dr. Tulp zuJochen Ebmeiers Realien; zu Philosophierungen
Wann wurde aus der Fähigkeit zum Heilen eine Wissenschaft? Der Historiker Robin Lane Fox legt sich auf wenige Jahre im 5. Jahrhundert v. Chr. fest.
von Robin Gerst
Wer
den Untertitel des Buchs nicht aufmerksam liest, erlebt eine
Überraschung. Denn es geht Robin Lane Fox nicht um eine historische
Untersuchung der Medizingeschichte im alten Griechenland, vielmehr
möchte er den Zeitpunkt bestimmen, wann sich die Medizin in der
griechischen Antike als Wissenschaft nach gelebten Regeln,
wiederkehrenden Analysen und fester Methodik, eingebettet in einen
ethisch-philosophischen Kontext, manifestiert.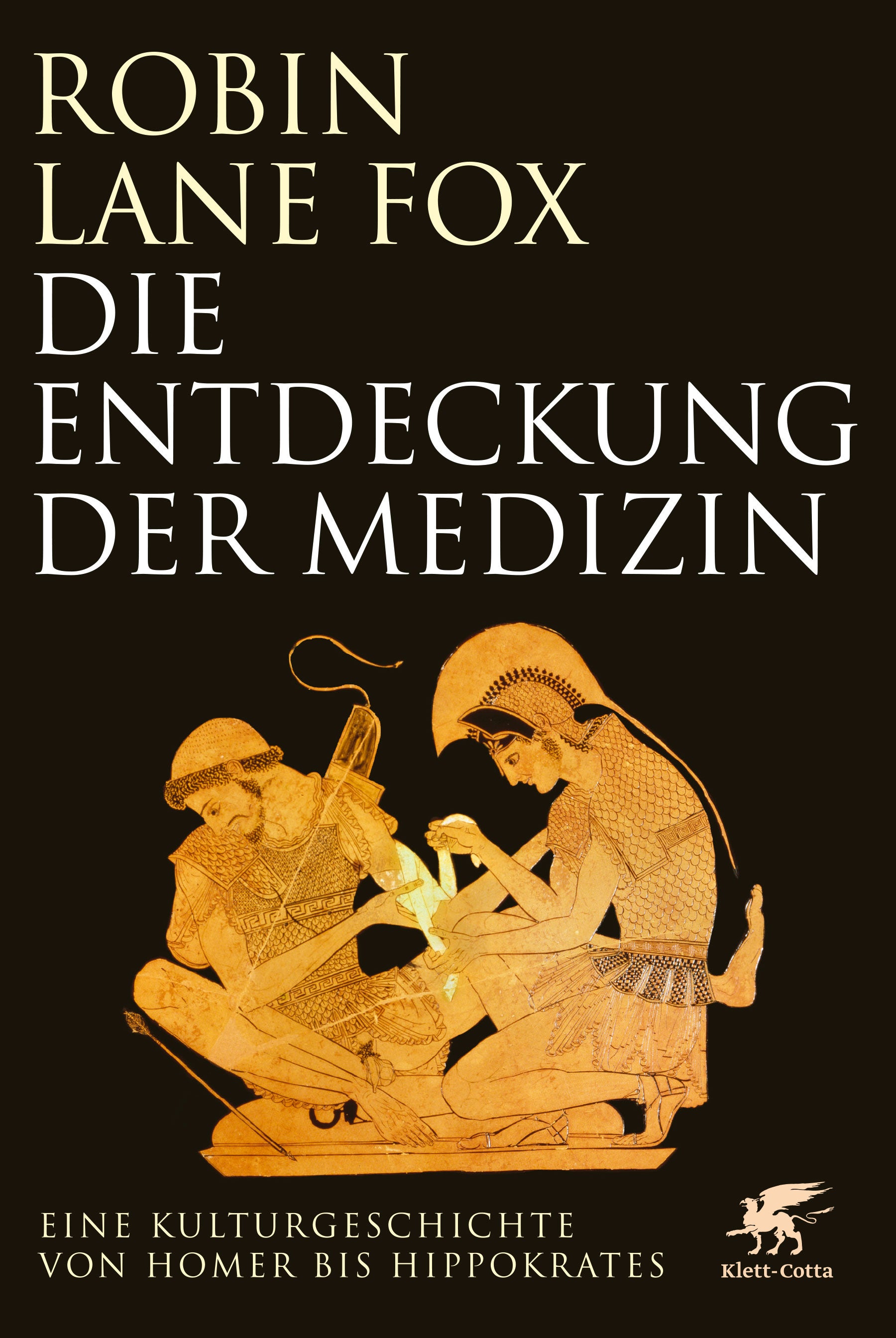
Die Geburt einer neuen Wissenschaft
So
gelingt es ihm, in historischen Quellen das erste Auftauchen einer
Wissenschaft »Medizin« nachzuweisen: zwischen 471 und 467 v. Chr. auf
der blühenden Insel Thasos im nördlichen Griechenland. Der Weg, wie Fox
zu diesem Resultat kommt, ist faszinierend und amüsant zu lesen, denn an
pointierten Kommentaren mangelt es nicht.
Der Althistoriker fokussiert sich dabei auf geschriebene antike Quellen, lässt aber auch archäologische Funde und ikonografische Untersuchungen einfließen. Es ist mehr eine philologisch-kulturhistorische Untersuchung antiker Medizinfachliteratur und Texte mit einem Bezug zu Körper, Krankheit und Heilung denn eine Darstellung von Medizingeschichte und Fallberichten der Heilung.
Das Werk ist in drei Abschnitte eingeteilt. Der erste führt in die Medizin der griechischen Antike ein und bettet sie ins damalige Alltagsleben ein. Im folgenden Teil interpretiert und datiert Fox zwei in seinen Augen eng zusammengehörende Werke der »Hippokratischen Bücher«, einer antiken medizinischen Textsammlung. So ordnet er diese beiden einem historischen Verfasser zu, der vier Jahre auf Thasos lebte, praktizierte und seine Studien niederschrieb. Im dritten Abschnitt analysiert er diese beiden Schriften sprachlich und kulturhistorisch tiefschichtig. Damit einher gehen eine intensive und anschauliche Charakterisierung des vor 2500 Jahren lebenden Griechen, jenes ersten Mediziners, sowie eine Rekonstruktion seiner Denkweise, die erstaunlich modern wirkt: rationale Beobachtung und Prognosen an Stelle von spirituellem Beten und Opfern.
Auf
den ersten Blick mag es enttäuschend scheinen, dass der Historiker nur
eine geringe Darstellung der antiken Medizin und deren Entwicklung
thematisiert. Nicht griechische Quellen wie ägyptische oder
vorderasiatische erwähnt er lediglich als Randnotiz. Allerdings gelingt
es ihm mit seinem Fokus auf die Zeit zwischen Archaik und Klassik und
mit seiner umfassenden, vielschichtigen und äußerst lebendigen
Darstellung der griechischen Gesellschaft, ein Bild derselben zu
erzeugen, die ihresgleichen sucht.
Fox beschreibt ausführlich die Wechselwirkung zwischen Kunst, Philosophie, Naturwissenschaften und Medizin und wie diese einander beeinflussten. Kleinteilig untersucht er das Vorkommen von antiken Fachtermini in antiken medizinischen Texten und wie sich Sprache und Begriffe verändern. Ebenso macht er deutlich, wie sich bereits in der Antike Lehrmeinung, aber auch der Beruf des Arztes und die damit verbundene Berufsphilosophie entwickelten. Interessant sind dabei unter anderem die an vielen Stellen beiläufig eingebrachten antiken Auffassungen, die aus heutiger Sicht bisweilen abstrus wirken, etwa dass Muttermilch aus Menstruationsblut entstehe.
Allerdings baut die vielschichtige und anschauliche Präsentation einer lebendigen Antike auf vielen Argumentationsketten und Hypothesen auf, die der Autor als Basis für weitere Vermutungen sieht. Sein Medium ist das geschriebene Wort, wobei er Quellen aus mehr als 1000 Jahren Wirkung und Reflexion verwendet. Dabei ist kaum ein Primärwerk, auf das er sich bezieht, erhalten, sondern in der Regel nur spätere Abschriften und Kommentare.
Nota. - Der Überlieferung nach ließ Iwan der Schreckliche dem Baumeister der Moskauer Basilius-Kathedrale - Jakowlew -, als das Werk vollendet war, die Augen ausstechen und die Zunge herausreißen, damit er sein Wissen nicht weitergeben konnte.
Das ist wohl nicht wahr, aber vorstellbar. Denn so ist die Baukunst entstanden: indem ein Meister seine Schüler in seine Geheimnisse einweihte. Eine breitere Basis erhielt sie in Europa, als bei den großen Kathedralen Bauhütten entstanden, wo viele Meister viele Schüler anlernen konnten - und die eifersüchtig über ihre Exklusivität wachten. Aber nicht alle Meister blieben am Ort, sondern zogen quer durch Europa von einer Baustelle zur andern.
Doch bloßes Erfahungswissen bleibt, wie sorgfältig es auch bewahrt wird, unzuverlässig. Es geschah immer wieder, dass große Bauwerke noch während ihres Entstehens einstürzten. Überprüfbares Wissen, Wissenschaft, wurde daraus erst, als Galileo die mathematische Statik begründete.
Begriffe ohne Anschauung sind leer, das ist wohl wahr, aber Anschuunf ohne Begriff ist blind. Das ist eine Theorie: ein Satz von Begriffen, die untereinander in einem systematischen Verhältnis stehen, die erlauben, bloßes Erfahrungswissen von Zufälligkeiten zu reinigen und kostspielige Misserfolge zu vermeiden. Und doch konnte Andreas Schlüter noch zwei Generationen nach Jakowlew nicht verhindern, dass ihm sein Berliner Münzturm einstürzte. Alle Wissenschaft hat immer auch Lücken.
Die aufzuspüren ist wiederum Sache der Theorie selbst. Sie ist an ihrem Anfang - an ihrem sachlich-positiven Anfang - Kritik, denn so sind die Begriffe entstanden: aus kritischen Reflexion auf die Erfahrungsdaten. Aber nicht nur auf die, sondern ebenso auf die Erzeugnisse der bloßen Spekulation. Erfahrung und Einbildung begrenzen das Feld des bewährten geprüften Wissens, in der Spannung zwischen beiden behauptet es seine Unabhänigkeit. Erfahrung kann täuschen, dauerhaft ist allein der Begriff - dieser eleatische Grundgedanke hat über die platonische Ideen-Lehre das westliche Denken und unsern gesunden Menschenverstand geprägt und ist bis heute unausrottbar.
Kommen wir endlich auf die Medizin. Sie ist, wie die Baukunst, entstanden als ein Spezialwissen - medecine men nannten die Euro-Amerikaner die Schamanen der dortigen Eingeborenen - von Eingeweihten, anvertraut vom Vater auf den Sohn. Das waren chirurgoi, wörtlich: Hand-Werker. In den poleis, den kultivierten städtisfhen Zentren, fanden sich - und von denen allein scheint Fox wissen zu wollen - wohl auch gelehrte Köpfe, die mit Dichtern und Philosophen zur intellektuellen Elite zählten, und von denen - von denen allein: Hippokrates, Galenus et. al. - sind Texte überliefert, die ein Philologe zitieren kann, und die werden vornehmlich andere Angehörige der Elite kuriert haben. Keine Texte haben hinterlassen die weisen Frauen auf dem Lande und die Wundheiler, die die Krieger nach geschlagener Schlacht wieder zusammenflickten. Und an die werden sich auch jene Bewohner der kultivierten Zentren gehalten haben, die nicht zur Elite zählten.
Dass medizinisch Gelehrte und chirurgoi nicht nur faktisch, sondern auch förmlich und standesmäßig auseinandertraten, war historisch gesehen ein Fortschritt, der unmittelbar aber einem Rückschritt geschuldet war, nämlich dem Untergang der antiken Kultur während der sogenannten Völkerwanderung. Als deren isolierte Restposten waren die Bischofssitze übriggeblieben, und was an Gelehrsamkeit überlebt hatte, sammelte sich hier. Hier und nirgend anders entstanden Schulen und Universitäten, die nun keine privaten Wandelhallen mehr waren, sondern hochoffizielle, sozusagen "öffentliche" Einrichtungen. Hier war die Gelehrsamkeit unter sich, sie unterstand als solche der römischen Kirche, die allein sie gegen die weltliche Herren schützen konnte und - wollte.
So wurde aus dem Unterschied zwischen gewöhnlichen Wundheilern und den gelehrten Ärzten der Vornehmen ein Standesunterschied zwischen Praktikern , die "alles konnten und nichts wussten", und akademishen Medizinern, die alles wussten und nichts konnten.
Eine Wissenschaft für alle und ein allgemeiner Berufsstand ist daraus geworden, als... nein, nicht die Gelehrsamkeit in die ärztliche Praxis, sondern das praktische Experiment in die Gelehrsamkeit eingebrochen ist; nämlich die Anatomie. Die kam - wie "die Vernunft" überhaupt - im 17. Jahrhundert auf. Sie hatte gegen die Theologen aller Konfessionen über Generationen ein schweren Stand und musste ihr Material des Nachts von den Galgen und den Gottesackern stehlen.
Den Treffpunkt verkörpert der als Doktor historisch gewordene François Quesnay. Der war ein Kupferstecher, und als solcher illustrierte er das Werk des englischen Mediziners William Harvey über den Blutkreislauf. In die Geschichtsbücher gelangte er als der Begründer der Politischen Ökonomie (das Wort hat ein andrer erfunden), die er ebenfalls als Kreislauf darstellte. Doch in unsern Zusammenhang gehört er, weil er noch als Kupferstecher gegen die damals grassierende Mode der Aderlasse aufgetreten war: Sie hätten überhaupt nur eine Wirkung, schrieb er unter Berufung auf Harvey, wenn sie in unmittelbarer Nähe des Krankheitsherdes vorgenommen werden. Seine Schrift machte Furore, und er wandte sich ganz diesem Thema zu. Da er Medizin nicht studiert hatte, brachte er es nur zum Chirurgicus, doch immerhin berief ihn die Gräfin Pompadour zu ihrem Leibarzt und er bezog Wohnung im Schloss von Versailles. Und schließlicn erlangte er doch noch den akademischen Doktograd, der ihn bis heute in allen Lehrbüchern an Stelle seines Vornamens ziert. Die ökonomische Lehre, die ihm dort seinen Platz eingetragen hat, entwickelte er erst in Versailles.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde - nicht zuletzt im Namen der Nation - Volksgesund-heit zu einem öffentlichen Auftrag, und heilende Tätigkeit zum Monopol einer akademischen Ärzteschaft. Nicht nur die Ausübung des Berufs, sondern schon die Ausbildung dazu wurde allgemeinen Normen unterworfen. Wissenschaftlichkeit wurde dem Ärztestand okroyiert, indem er öffentlich bestallt und öffentlich kontrolliert wird. Kritik ist institutionell geworden, und dass sie ihrem Wesen nach ohne Grenzen ist, macht sie zum Beispiel gegen große Seuchen unentschlossen und langatmig; doch ein anderes Mittel, dauerhaften Schaden zu verhindern, gibt es schlechterdings nicht.
JE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen