
Psycho-Revolution zuJochen Ebmeiers Realien;
Neustart für die Diagnosen der Psychiatrie
Zwanghafte,
dissoziale oder paranoide Persönlichkeit – das sind gängige Dia-gnosen
der Psychiatrie. Kritiker sagen: Es sind Schubladen, in die Patienten
nicht wirklich passen. Das überarbeitete Handbuch will
Persönlichkeitsstörun-gen in Zukunft differenziert erfassen – und
streicht Narzissmus aus dem Kata-log.
„Ich
habe immer verschiedene Diagnosen bekommen, aber ich habe es den Leuten
auch nicht recht gemacht“, sagt Leonard Anders, ein Patient.
Diagnose:
Persönlichkeitsstörung. Typ eins: Narzissmus. Typ zwei: Zwanghafte
Persönlichkeit. Typ drei: Dissoziale Persönlichkeit. Typ vier: Paranoide
Persönlichkeit. Typ 5: Borderline. Und so weiter. Mit all dem soll
Schluss sein.
Neues Diagnosehandbuch ICD-11 tritt in Kraft
„Es
ist eine gewisse Sensation, denn in der Medizin, in der Psychiatrie wird
einfach viel in einem Krankheitsmodell gedacht, das heißt ab hier ist
krank, ab da ist gesund. Und das ist eben die Revolution, wenn man so
will: So ist es nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in diesen vielen
verschiedenen Persönlichkeitsstörungsdiagnosen“, sagt Babette Renneberg, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der FU Berlin.
Die Sensation oder Revolution, die sie beschreibt, findet sich im ICD-11,
dem neu überarbeiteten Diagnosehandbuch der
Weltgesundheitsorganisation. Das ICD-11 streicht zum 1. Januar 2022 die
bisherigen spezifischen Persönlichkeitsstörungen aus dem Katalog. Kein
Narzissmus mehr, keine paranoide oder dissoziale Persönlichkeitsstörung.
Es gibt nur noch die allgemeine Diagnose „Persönlichkeitsstörung“. Dazu
Kriterien, die umschreiben sollen, wie viel Hilfe jemand braucht. Eine
radikale Abkehr vom bisherigen Weg der Schulpsychiatrie. Denn die hatte
die Kategorien einst eingeführt, um unterschiedliche Auffassungen und
Theorien unter einen Hut zu bringen.
„Mit
der Einführung dieser Diagnostik war es zum ersten Mal möglich, dass
verschiedene Diagnostikerinnen zu demselben Ergebnis kamen. Das ist ja
schon einmal viel wert, dass sowohl meine Kollegin in München mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit zum selben Ergebnis gekommen ist wie die
Kollegin in Dortmund.“ Der Patient sollte Klarheit erhalten: Du bist ein
Narzisst, du hast Borderline, Depression oder Schizophrenie. Warum gibt
man so etwas auf?
Ein Lebenslauf als Psychiatrie-Lehrstück
„Ich
war sehr lebendig, sehr neugierig, sehr lebhaft“. Leonard Anders. Sein
Lebenslauf ist ein Lehrstück aus der widerspenstigen Praxis der
Psychiatrie. Nicht nur sein Name ist ein Pseudonym, auch seine Stimme
ist verfremdet. Leonard Anders möchte nicht erkannt werden.
„Probleme
hatte ich dann schon immer als Kind. Ich bin Scheidungskind, bin dann
umgezogen mit fünf, sechs, das war schon der zweite Umzug, bin aus
meinem Freundeskreis, aus meinem gewohnten Umfeld herausgerissen worden,
also ich bin immer der Neue gewesen, musste mich immer wieder neu
einfinden, anpassen“.
Nur
bei seinen Großeltern findet Anders wirklich Halt und Anerkennung, bis
diese sterben. „Und hatte immer so das Gefühl, nicht verstanden zu
werden, also ich habe mich immer sehr, sehr anders gefühlt. Ich hatte
auch das Gefühl, man hört mir gar nicht richtig zu, man hört nicht auf
das, was ich sage, dann wird halt viel verstanden und auf mich gepresst
und ich entspreche dieser Form nicht.“
Leonard
lässt sich gern fotografieren. Seine Mutter macht ihn deshalb zum
Kindermodel. Seine Schulkameraden sehen ihn im Kino und Fernsehen.„Und
entsprechend führte das natürlich auch auf dem Schulhof zu Neid, und die
Kinder haben halt gedacht, ich würde mich für was Besonderes halten,
nur ich wollte eigentlich nur dazugehören. Ich wollte auch keine
Autogramme schreiben, ich wollte auch nicht für die anderen Kinder
singen, die Kinder haben halt teilweise mich dazu gebracht, wie das halt
so ist und ich habe es dann halt auch gemacht. Ich habe dann vor den
anderen Kindern gesungen und habe auch Autogramme geschrieben.“
Fünf Kriterien für die Diagnose Narzissmus
Was
bleibt, ist der Eindruck, dass sich da jemand doch für etwas ganz
Besonderes hält. Nach der bisherigen kategorialen Einteilung der
Persönlichkeitsstörungen ist das ein Kriterium für Narzissmus. Aber,
betont Babette Renneberg, eben nur eines. Damit beginnen die Probleme.
Ein Narzisst muss mehrere Kriterien erfüllen:
„Da
sind es tatsächlich neun Kriterien, aus denen dann das zusammengestellt
wird. Das eine ist dieses grandiose Gefühl der eigenen Wichtigkeit, und
das zweite ist, dass die Personen ganz eingenommen sind von ihren
eigenen Fantasien über grenzenlosen Erfolg, Macht, Glanz, Schönheit und
auch von idealer Liebe. Und die Person glaubt von sich selbst, besonders
zu sein, einzigartig.“
Die
weiteren Kriterien: Die Person verlangt nach übermäßiger Bewunderung.
Sie erwartet, dass die anderen automatisch auf ihre Bedürfnisse
eingehen. Narzissten nutzen andere Menschen aus. Sie besitzen keine
Empathie, sie sind neidisch und arrogant. Das Problem: „Von diesen neun
müssen fünf erfüllt sein, um von einer Störung zu sprechen.“
Da
fünf Kriterien genügen, führt das dazu, dass Menschen als Narzissten
diagnostiziert werden, die sich stark voneinander unterscheiden. Manche
sind zum Beispiel arrogant und ausbeuterisch, andere nicht, dafür aber
neidisch und unempathisch. Außerdem treffen manche Kriterien auch auf
andere Persönlichkeitsstörungen zu. Arrogantes Auftreten zum Beispiel
auch für die so genannte ängstlich-vermeidende Störung.
„Diese
Person mit der ängstlich vermeidenden tut es aus Angst vor Kritik und
Ablehnung, die Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung,
die tun das, weil sie sich für besser halten.“
Psychiatrische Diagnosen überlappen sich
Die
Probleme von Leonard Anders nehmen früh überhand, Psychiater begutachten
ihn. Klarheit bringt das wenig. „ADHS mit zwölf. Mit 19 gab es den
Verdacht auf Borderline. Mit 24 kamen sie dann auf die Idee, dass ich
vielleicht dann doch kein Borderline hätte, sondern die
selbstunsicher-vermeidende Persönlichkeitsstörung. Das haben sie dann
auch wieder revidiert, da war ich 32.“
Anders
hält die Diskrepanz zwischen dem, was er will, und dem, was die anderen
von ihm erwarten, immer weniger aus. Er wird beneidet und gemobbt,
reagiert arrogant. „Da haben sie dann das erste Mal vermutet, dass ich
Narzisst sein könnte, mittlerweile sagen sie gar nicht mehr Narzisst. Am
Ende gab es dann halt diese Verdachtsdiagnose der kombinierten
Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen, histrionischen und emotional
instabilen Anteilen, allerdings auch nur ein Verdacht, also keine
feststehende Diagnose.“
Professor Sabine Herpertz
ist ärztliche Direktorin der Klinik für Allgemeine Psychiatrie an der
Universität Heidelberg. Das Problem, dass sich psychiatrische Diagnosen
überlappen und verändern, kennt sie zur Genüge.
„Ich
denke, wir haben in der Psychiatrie es generell mit dieser Problematik
dieser Komorbidität zu tun, also dass diagnostische Kriterien mehrerer
psychischer Erkrankungen gleichzeitig erfüllt werden. Bei den
Persönlichkeitsstörungen ist es dann so, dass eben ganz viele Patienten,
mehr als die Hälfte haben mehr als eine Persönlichkeitsstörungsdiagnose
bis dahin; ich sag mal, dass ein armer Mensch drei oder fünf
Persönlichkeitsstörungsdiagnosen bekommt. Und daraus wird einfach sehr
klar, dass diese Kategorien nicht sinnvoll sind.“
Nicht
das einzige Problem, mit dem die klassischen Diagnosen zu kämpfen
haben. „Ein weiterer Punkt ist, dass viele empirische Untersuchungen
gezeigt haben: es gibt keine kategoriale Trennung zwischen einer
gesunden, einer normalen Persönlichkeit und einer gestörten
Persönlichkeit, sondern es ist im Grunde ein Kontinuum und natürlich ab
einem bestimmten Punkt kann dann ein Hilfebedarf auftreten, aber es war
ein reines Expertenurteil, ab wann man von einer Persönlichkeitsstörung
spricht, wie man die Schwelle definiert.“
Warum
sind es gerade fünf und nicht sieben von neun Kriterien, die festlegen,
ob jemand narzisstisch ist und vom Durchschnitt abweicht? Das wurde
bisher in Expertenrunden entschieden, nicht aufgrund empirischer
Gewissheit.

Fragwürdige Wurzeln des Etiketts „Persönlichkeitsstörung“
„Wer
nimmt sich das Recht zu sagen, das ist eine gewünschte, übliche, von
mir aus sogar statistisch durchschnittliche Persönlichkeit, und was
bringt uns das?“ Der Berliner Psychiater Andreas Heinz
hält solche Expertenurteile über pathologische Schwellenwerte generell
für problematisch. Und er weist auf die fragwürdigen Wurzeln der
Kategorien hin. Heinz ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie am Campus Charité Mitte.
„Das
Schwierige an den Persönlichkeitsstörungen historisch ist, dass das
eine Klassifikation der Beleidigung von sozial missliebigen Gruppen
gewesen ist, also man hat gearbeitet mit „willensschwach“, „haltlos“,
man hat die aufständischen jüdisch-deutschen und nichtjüdisch deutschen
Revolutionäre nach dem Ersten Weltkrieg als Psychopathen gelabelt. Und
man ist auch davon ausgegangen, dass diese Persönlichkeitsstörungen
erblich sind und von Anfang an gegeben sind. Also der Unterschied
zwischen einer zwanghaften Persönlichkeit und einer Zwangsneurose wäre,
dass die zwanghafte Persönlichkeit konstitutionell schon immer zwanghaft
war, während bei der Neurose entwickelt es sich.“
Das
Etikett, eine „zwanghafte“, „narzisstische“ oder „ängstlich-vermeidende“
Persönlichkeit zu sein, stigmatisiert noch immer. Es suggeriert, dass
ein Mensch anders ist und so bleiben wird. Aber das stimmt nicht.
Persönlichkeitsstörungen müssen keineswegs von Kindheit an bestehen und
lebenslang stabil bleiben. Das belegen Langzeitstudien inzwischen ganz
klar. Damit ist auch das Kernkriterium hinfällig geworden, mit dem die
Persönlichkeitsstörungen traditionell von anderen Störungen abgegrenzt
wurden.
Suche nach der richtigen Therapie
„Die
haben nicht großartig mit mir darüber gesprochen, die haben Diagnostik
gemacht.“ Leonard Anders lässt sich auf mehrere Therapien ein, macht
dabei immer aufs Neue die Erfahrung, dass ihn auch die Therapeuten in
eine Schublade stecken wollen. Manchmal muss er sich sogar dafür
rechtfertigen, dass er nicht richtig ins Schema passt.
„Mal
haben sie die erste Diagnostik kassiert, weil nach der ersten
Diagnostik war ich gar nicht psychisch krank. Sie haben dann gefragt, ob
ich den Test manipuliert hätte, habe ich aber nicht, weil ich habe ihn
nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt, sogar unter Aufsicht und
habe den dann abgegeben und da haben die gemeint, laut dem Test bin ich
gesund. Also die könnten nichts diagnostizieren bei mir.“
Anders
wird immer skeptischer. Er beginnt sich selbst in die Materie
einzuarbeiten und macht sich zu den Diagnosen seine eigenen Gedanken.
„Ich
habe mich dann mit all diesen drei Persönlichkeiten mal
auseinandergesetzt: Emotional instabil, Borderline? Habe ich gesagt nee,
bin ich nicht. Histrionisch, dieses permanent im Mittelpunkt stehen
müssen, war auch nicht meins, ich wollte eigentlich immer nur meine
Ruhe, wollte permanent in Ruhe gelassen werden und gesagt bekommen, dass
ich gut genug bin, wie ich bin. Und dann habe ich Narzissmus gelesen
und ich habe mich mit Narzissmus dann wirklich ein bisschen
auseinandergesetzt, habe dann aber auch irgendwie festgestellt, sehr
schnell: das bin ich ja gar nicht, ich habe vielleicht Anteile einer
narzisstischen Persönlichkeitsstörung, aber doch nicht alles.“
Ohne Kategorien droht Beliebigkeit
Die
Diskussion darüber, wie man psychiatrische Diagnosen flexibler und
besser an den individuellen Fall anpassen kann, läuft schon seit vielen
Jahren. Die Crux: Wenn man die alten Kategorien aufgibt, droht wieder
die Gefahr der Beliebigkeit. Die Therapeuten könnten sich dann auch
schlechter darüber verständigen, was sie wie behandeln.
Nur
bei den Persönlichkeitsstörungen hat man sich im neuen ICD-11 überhaupt
der Herausforderung gestellt. Hier hatten die Probleme einfach
überhandgenommen. Immer häufiger retteten sich die Psychiater in die
unklare Diagnose „Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet“. Und
so wird dieses Störungsbild jetzt zum Testfall für die Zukunft der
gesamten Psychiatrie.
Kann
der Brückenschlag gelingen? Wird es mit dem neuen ICD-11 leichter,
Diagnosen zu erstellen, die Zusammenhänge zwischen den Symptomen
treffsicherer als bisher beschreiben, was auch der Forschung hilft? Und
die offen dafür sind, welches Symptom bei den Patienten welches Leid
hervorruft, um am Ende gezielter zu helfen? Babette Renneberg von der FU
Berlin: „Auch da gibt es Fragebögen und auch da würde ich erst einmal
zuhören, also was ist denn da dran? “
Die
Sicht der Betroffenen auf ihre Probleme sollen Richtschnur sein. Welche
Verhaltensweisen hat ein Patient entwickelt? Woran scheitert eine
Patientin im Alltag, wie stark leidet sie? „Das verspricht jetzt das
neue System tatsächlich, dass man dort vielleicht etwas weiter kommt mit
der Möglichkeit, die Person eher zu beschreiben.“ Gleichzeitig gibt das
ICD-11 den Allgemeinheitsanspruch von Diagnosen nicht auf. „Denn
Achtung! Auch im neuen System gibt es eine Kategorie der Einteilung:
Persönlichkeitsstörung liegt vor oder nicht.“
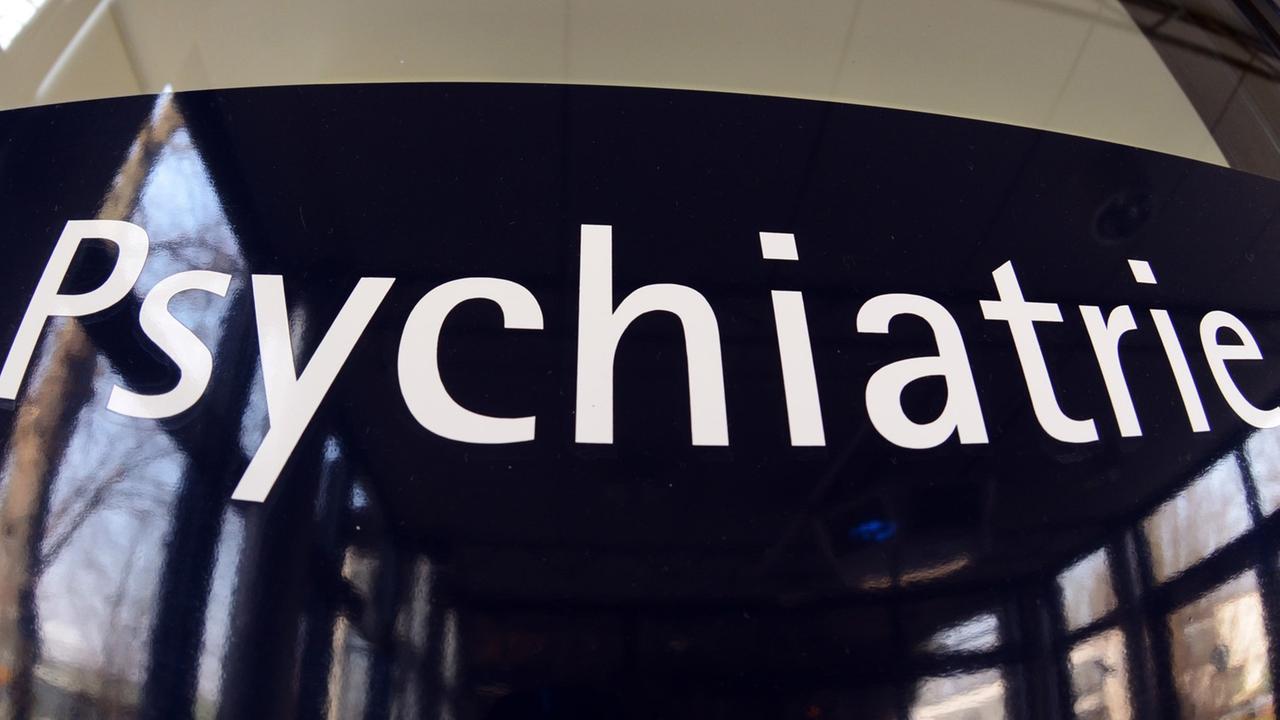
Kriterien für die Feststellung einer „Störung“
Zwei
Kriterien sollen das Urteil ermöglichen, ob jemand überhaupt eine
Persönlichkeitsstörung hat. Das erste bezieht sich auf sein so genanntes
„Selbst-Funktionsniveau“. Wie stabil ist sein Selbstbild und sein
Selbstwertgefühl? Das zweite Kriterium betrifft das sogenannte
zwischenmenschliche Funktionsniveau. Sabine Herpertz vom
Universitätsklinikum Heidelberg:
„Da
wäre die Frage, ob man in der Lage ist, Beziehungen einzugehen, ob man
in der Lage ist, die Perspektive anderer Menschen zu übernehmen, also
was letztendlich Empathie meint. Und ist man in der Lage, Konflikte zu
lösen und auch intime Beziehungen in wechselseitig befriedigender Weise
zu führen? Diese Fragen würde man mit den Patienten durchgehen und ich
finde schon, dass man darüber sehr gut ins Gespräch kommt, und das ist
jetzt eigentlich viel näher zur Diagnostik, darüber zu sprechen.“
Hat
ein Patient in den beiden Bereichen Probleme, erhält er die Diagnose
„Persönlichkeitsstörung“. Wobei im Unterschied zum alten Katalog ICD-10
sofort auch der Schweregrad bestimmt werden soll. „In wie vielen
Lebensbereichen zeigt sich das Ganze? Hat jemand nur Probleme am
Arbeitsplatz, weil er mit seinem Chef nicht klar kommt, oder hat er
überall Probleme, in der Partnerschaft, mit seinen Kindern, mit
Freunden, ist damit einfach sozial isoliert? Und dann hat er eben eine
schwere Persönlichkeitsstörung.“
Fünf „Dimensionen“ für die Einzelfall-Analyse
Wenn
geklärt ist, ob ein Patient unter einer leichten, mittleren oder
schweren Persönlichkeitsstörung leidet, sollen die Psychiater den
Einzelfall näher analysieren. Der Fachbegriff heißt „Dimensionale
Diagnose“. Dafür bietet das ICD-11 fünf Dimensionen an. Die erste ist
die sogenannte „Negative Affektivität“:
„Also
das heißt wie stark die Person negativ denkt. Und das andere ist
‚Dissozialität‘, da versteht man eben diese Selbstbezogenheit darunter
und diesen Mangel an Einfühlungsvermögen in andere, das
Unbedingt-Durchsetzen-Wollen der eigenen Bedürfnisse. Es gibt diese
‚soziale Distanziertheit‘, das heißt aber einfach, dass die Personen
große Schwierigkeiten haben, in Kontakt mit anderen zu treten, und sich
von anderen eher fernhalten.“
Fehlen
noch die „Hemmungsschwäche“ und die „Zwanghaftigkeit“. Mit diesen fünf
Dimensionen soll die Vielfalt der Persönlichkeitsstörungen flexibel
erfasst werden, ohne sie in allzu starre Schubladen zu pressen. Ein
Patient kann dann problemlos mehrere Dimensionen aufweisen.
Überlappungen sind kein Problem mehr, sondern dienen dazu, dem realen
Patienten gerecht zu werden. Können die Psychiater so noch erfassen, was
sie bisher narzisstische Störung genannt haben? Babette Renneberg:
„Das
ist sozusagen eine Übersetzungsarbeit, die alle noch lernen müssen, die
auch nicht auf der Hand liegt. Wir haben jetzt eben gerade bei der
narzisstischen Persönlichkeit, glaube ich, diese so genannte
Dissozialität, also dieses Andere ausnutzen, nicht-sich-einfühlen-können
als ein charakteristisches Merkmal, gepaart mit einer negativen
Affektivtät, also mit negativem Denken über andere et cetera.“

Suizidversuch und Psychiatrieaufenthalt
„Ich
habe halt aufgrund diverser Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich
Konflikte hatte, vermieden.“ Das Selbstwertgefühl von Leonard Anders
schwindet immer weiter. Er versucht sich in immer neuen Jobs, arbeitet
in einem Schnellrestaurant, einem Blumenladen, einem Callcenter. Er hat
zwar eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, bekommt aber nur
Absagen.
„Ich
habe mich aus sämtlichen sozialen Situationen zurückgezogen, ich habe
Feierlichkeiten gemieden, ich bin nirgendwo mehr hingegangen aus Angst
anzuecken, also ich bin teilweise vermummt und mit Kapuze, so dass man
mich auch nicht erkennt, einkaufen gegangen.“
Anders
versucht sich umzubringen, lebt eine Zeitlang auf der Straße, verbringt
fast ein Jahr durchweg in der Psychiatrie. Und schafft es,
selbstständiger zu werden.
„Ich
frage jetzt halt immer ‚Was habe ich gesagt?‘ oder ‚Was hast du
verstanden?‘, und wenn ich das Gefühl habe, der Therapeut hat mir
zugehört, dann rede ich mit ihm. Wenn ich das Gefühl habe, der hat mir
eben nicht zugehört, der war auch nicht empathisch, ich interessiere ihn
gar nicht, dann möchte ich auch nicht zumindest mich von ihm behandeln
lassen.“
„Störung“ versus Psychose
Eine
Diagnose nach dem ICD-11 zu erstellen wird länger dauern als bisher,
davon sind seine Verfechter und Verfechterinnen überzeugt. Schließlich
wolle man den individuellen Fall differenzierter als bisher erfassen.
Kann das funktionieren?
„Ich
denke, es ist gut, dass die Unterschiede im Schweregrad jetzt im
Vordergrund stehen, das entspricht auch der empirischen Evidenz, dass
das einfach relevanter ist für verschiedenste Entscheidungen, auch für
prognostische Überlegungen.“ Also dafür, wie sich die Erkrankung
entwickeln wird, meint Johannes Zimmermann.
Er ist Professor für Differentielle und Persönlichkeitspsychologie an
der Universität Kassel und begrüßt die Neuerungen im ICD-11 zum Teil.
„Die
Einteilungen bezüglich dieser Dimensionen passen jetzt auch besser zu
dem empirisch gesicherten Wissen darüber, welche Probleme eigentlich
häufig gemeinsam auftreten. Also das ist ein Schritt in die richtige
Richtung.“
Zimmermann
übt aber auch Kritik. Lässt sich eine Persönlichkeitsstörung zum
Beispiel klar von einer Psychose abgrenzen? Nach dem ICD-11 sollen die
Therapeuten bei der Persönlichkeitsstörung danach fragen, wie stabil und
kohärent die Identität einer Person und ihr Beziehungsverhalten ist.
Aber auch Psychotiker leiden unter einer zerrissenen Identität und
zwischenmenschlichen Problemen.
„Dann
kann man dann diese Abgrenzung zwischen Persönlichkeitsstörungen und
anderen psychischen Störungen schon nicht mehr so scharf hinbekommen.
Das bedeutet, es hängt auch sehr davon ab, wer diese Beurteilung
vornimmt.“
Soziale Hintergründe
Die
Diagnosesteller brauchen sehr viel Erfahrung und vor allem gute
Fragebögen. Die aber sind erst ansatzweise für das ICD-11 entwickelt,
weiß auch Babette Renneberg von der FU Berlin. Sie hat weitere
Kritikpunkte. Die fünf Dimensionen sind ihr zum Teil nicht trennscharf
genug. Etwa die „Negative Affektivität“.
„Ich
finde negative Affektivität ist ein riesengroßes Feld, das trifft auf
ganz viele Menschen, die psychische Störungen haben, zu. Jeder, der eine
depressive Episode hat, denkt negativ über sich und über andere und
über die Welt, fühlt sich innerlich leer, hat ganz große
Schwierigkeiten, aus diesem negativen Loch und Denken herauszukommen.
Genauso Menschen, die Angststörungen haben. Ich finde, nichts davon ist
charakteristisch für eine Persönlichkeitsstörung.“
Womöglich
verführen die fünf Dimensionen, die man abfragen kann, auch dazu, die
sozialen Hintergründe der Symptome zu vernachlässigen. Das ist die Sorge
von Andreas Heinz von der Berliner Charité.
„Hemmungsschwäche!
Wenn Sie das sich anschauen, das fungiert oft unter dem Aspekt der
Impulsivität und die Menschen, denen das diagnostiziert wird, Menschen,
die auf kurzfristige Belohnung statt auf langfristige setzen und wenig
Impulse hemmen, haben ganz oft einen sehr guten Grund dafür. In meinen
Studien korrelierte so etwas immer mit Armut. Wenn sie arm sind, dann
können Sie, wenn ich sie frage, ob sie jetzt zehn Euro wollen oder
tausend Euro in einem Monat, dann sagen Sie jetzt zehn Euro, weil sie
jetzt etwas zu essen kaufen müssen. Das ist keine Impulsivität, schon
keine Hemmungsstörung, sondern soziale Ungleichheit.“
Kompromiss sinnvoll?
Es
gibt also einige Argumente dafür, die Dimensionen noch genauer zu fassen
und ihre sozialen Hintergründe zu beleuchten. Einige Psychiater und
Therapeuten lehnen den dimensionalen Ansatz aber grundsätzlich ab und
schwören auf die alten Kategorien. So weit geht Babette Renneberg nicht,
aber sie ist erleichtert, dass das ICD-11 nicht alle
Persönlichkeitskategorien gestrichen hat.
„Das
war aber ein harter Kampf und es ist auch so, dass das für die
Borderline-Persönlichkeitsstörung wichtig war, dass die als Kategorie
erhalten bleibt. Warum? Weil wir dort tatsächlich wirksame
evidenzbasierte Behandlungsansätze haben. Und wenn wir auf einmal die
Diagnose nicht mehr stellen, dann werden diese Personen vielleicht auch
nicht mehr so zuverlässig zu diesen wirksamen Behandlungsansätzen
zugewiesen, das war ein großes Problem.“
Wenn
es nach Renneberg geht, hätte auch die ängstliche-vermeidende
Persönlichkeitsstörung als Kategorie erhalten bleiben sollen, weil auch
für sie gute Behandlungsansätze existieren. Da, wo es gute
Behandlungsansätze für ein Störungsbild gibt, sollte man die Kategorien
erhalten, in den anderen Fällen wäre die dimensionale Diagnose
anzuwenden. Das wäre ein guter Kompromiss, sagt Babette Renneberg.
Sabine Herpertz hat zwar gemeinsam mit ihr ein Buch zum Thema geschrieben, sieht den Ansatz aber grundsätzlich kritisch.
„Wenn
man jetzt die Persönlichkeitsstörungsdiagnostik noch komplexer macht
wie die bei diesem Hybridmodell ist, dann kann das für die Forschung
vielleicht Sinn machen, bin ich aber auch nicht von überzeugt. Aber das
wäre eine Komplexität, die da abgebildet ist, die ist für einen normalen
Kliniker kaum mehr umsetzbar. Und es hat eben die Gefahr dieser
Schubladen, wir sind gewöhnt daran, in solchen Krankheitsidentitäten zu
denken, die aber den Patienten nicht gerecht werden.“

Diagnosesysteme bleiben beschreibend
Das
Problem der psychiatrischen Diagnosen besteht darin, dass man bis heute
zu wenig über die biologischen Ursachen der Erkrankungen weiß. Zwar gibt
es große Anstrengungen, Hirnprozesse zu identifizieren, die bei
Depressionen, Schizophrenien oder anderen Erkrankungen eine Rolle
spielen. Aber diese sind häufig an verschiedenen Erkrankungen beteiligt.
Und
der Schwellenwert, ab wann ein gestörter Hirnprozess schweres
psychisches Leid verursacht, ist kaum objektiv zu bestimmen. Dafür ist
immer auch maßgeblich, wie ein Betroffener seine Symptome bewertet und
wie sozial eingebunden er ist. Die Diagnosesysteme müssen daher
weiterhin deskriptiv vorgehen, also die Erkrankungen beschreiben.
Entweder kategorial oder dimensional.
Wohin wird die Reise gehen?
Wohin wird die Reise gehen?
„Ich
bin ich selbst und habe unterschiedliche Dinge getan, um zu mir selbst
zu finden. Zum Beispiel habe ich meine ganzen Möbel weggeworfen, mir
ganz komplett neue gekauft, weil ich hatte noch die Möbel aus meiner
Kindheit hier bei mir. Jetzt habe ich mir sozusagen mein Reich
geschaffen, so wie ich es haben möchte und das hat mir schon geholfen.
Ich mach‘ mein Ding.“
Begriff „Persönlichkeitsstörung“ ganz abschaffen?
Das
ICD-11 beschränkt sich auf den pragmatischen Ansatz, andere gehen
darüber noch hinaus. Vor zweieinhalb Jahren hat sich etwa bundesweit
eine „Narzissmus Selbsthilfe“ gegründet, die den Begriff der
Persönlichkeitsstörung ablehnt.
Auch
Andreas Heinz von der Berliner Charité würde am liebsten auf die
Kategorie „Persönlichkeitsstörung“ ganz verzichten. Kategorien sind für
ihn nur für schwere psychische Störungen sinnvoll, etwa für Demenz,
Suchterkrankungen, schwere Psychosen oder Depressionen. Ansonsten
sollten seiner Meinung nach Therapeuten und Patienten möglichst
selbstständig aushandeln, welche Probleme zu behandeln. „Und wenn es den
Kollegen hilft, das dimensional zu erfassen, warum nicht. Ich würde
eher darauf verzichten, ich finde, wir Menschen sind zu komplex für drei
bis fünf Dimensionen.“
Einen anderen Weg wählt die internationale Initiative HiTOP.
HiTOP steht für „Hierarchische Taxonomie der Psychopathologie“. Sie
möchte die Anzahl der Dimensionen noch erweitern. Die Wissenschaftler
haben seit 2015 psychiatrische Studien und Lehrbücher durchforstet und
eine Liste von 200 Symptomen zusammengetragen. Johannes Zimmermann von
der Universität Kassel gehört zu den Forschern, die im zweiten Schritt
danach fragten, wie häufig bestimmte Symptome gemeinsam auftreten, also
„Syndrome“ bilden.
„Ein
Beispiel wäre, so etwas wie Anhedonie oder die Unfähigkeit, Freude zu
erleben und ängstliche Sorgen und traumatische Intrusionen und soziale
Angst, die treten häufig gemeinsam auf und deswegen kann man ihnen auch
ein gemeinsames Label geben, nämlich ‚Psychisches Leiden‘.“

Debatte wird weitergehen
Momentan
arbeitet die Initiative daran, auch zusammenhängende Syndrome zu
identifizieren, sogenannte „Unterfaktoren“. Das könnten zum Beispiel
alle Syndrome sein, die mit Essproblemen zu tun haben oder mit
Denkstörungen. Die HiTOP Initiative möchte aber auch diese Unterfaktoren
wieder zu neuen Einheiten zusammenfassen, den sogenannten „Spektren“:
Tendiert jemand eher dazu, seine Probleme nach innen zu richten wie
Depressive? Oder trägt er sie nach außen, verhält sich zum Beispiel
unsozial?
Die
HiTOP-Initiative ist der bisher wohl anspruchsvollste Versuch, eine
Brücke zwischen allgemeinen Einheiten und individuellen Problemen zu
schlagen. Ist es das, was Betroffene sich wünschen? Leonard Anders: „Ich
wünsche mir, dass man Menschen nicht mehr schubladisiert oder
einordnet, es fängt schon als Kind schon an, sondern dass man anfängt,
die Menschen ganzheitlich zu betrachten: Was geht in diesen Menschen vor
und vor allen Dingen sich zu fragen, was hat das Ganze denn mit mir zu
tun?“
Die
Debatten um die optimale Diagnose werden weitergehen. Sabine Herpertz
und Babette Renneberg sind davon überzeugt, dass es fünf bis zehn Jahre
dauern wird, bis das dimensionale Denken in den Köpfen der Psychiater
verankert ist. Und Johannes Zimmermann?„Ja, ich denke das ist realistisch und es ist einfach noch sehr viel zu tun.“
Nota. - Die reelle Medizin hat es vergleichsweise leicht. Sie hat einen sicheren Maßstab am Modell des störungsfrei funktionierenden Organismus. Kein Lebender sei zu hundert Pro-zent gesund? Vielleicht nicht. Aber man kann exakt beschreiben, wie sein Organismus un-gestört funktionieren würde. Man wird eine Marge hinzurechnen, innerhalb derer Abwei-chungen tolerabel sind, und man wird berücksichtigen, dass mehrere kleine Beschwerden zusammen wie eine große Beschwerde wirken mögen; und so weiter: Im Detail werden allüberall tausend Spezifizierungen angezeigt sein, aber das beschädigt nicht den Maßstab, sondern immer nur die Gewissheiten der Messenden.
Mit der Seelen-Medizin ist es ganz was anderes. Auch der größte Irrsinn, auch die abscheu-lichste Perversion stellt immer nur eine Variante einer menschlichen Verhaltensmöglichkeit dar - ins äußerste Extrem verzerrt und vereinseitigt ohne ausgleichende Gegenspieler; die aber doch in geringer Dosis überhaupt nicht auffallen, sondern das Subjekt individualisieren und vielleicht sogar liebenwert machen würde. Abweichend und gestört erscheint es immer erst, wenn es die Umgebung stört. Oder wenn der Leidensdruck zu groß wird? Der Leidens-druck entsteht letzten Endes wiederum aus der Unverträglichkeit mit den Anforderungen der Umwelt, ohne die ein menschlicher Organismus doch nicht überleben kann.
Nicht nur die Gewissheiten der Messenden sind hier problematisch - sondern das Bild von einem unbeeinträchtigten Organismus selbst ist nicht klar zu bestimmen. Es wird immer, welche Doktrin, welche Taxonomie man auch zugrunde lege, ein Abwägen von zu viel Hier-von oder zu wenig Davon nötig werden. Der 'Schweregrad' der 'Störung' wird sich nie mes-sen und in Daten objektivieren, sondern immer nur subjektiv einschätzen lassen. Die Er-wartungen des Patienten (und seiner Familie) an die Psychiatrie sind menschlich verständ-lich, aber sachlich nicht gerechtfertigt. Die können nur tun, was sie - können; der eine mehr, der andere weniger.
Doch das zu tun, muss ihnen möglich gemacht werden. Große Kliniken mit ihren Verwal-tungserfordernissen neigen dazu, es einzuschränken. Die psychiatrische Wissenschaft muss ihnen dabei nicht auch noch taxometrisch entgegenkommen, das ist wahr.
JE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen