Urteil ist im höchsten und strengsten Sinne die ursprüngliche Trennung des in der intellektualen Anschauung innigst vereinigten Objekts und Subjekts, diejenige Trennung, wodurch erst Objekt und Subjekt möglich wird, die Ur=Teilung. Im Begriffe der Teilung liegt schon der Begriff der gegenseitigen Beziehung des Objekts und Subjekts aufeinander, und die notwendige Voraussetzung eines Ganzen, wovon Objekt und Subjekt die Teile sind. »Ich bin Ich« ist das passendste Beispiel zu diesem Begriffe der Urteilung, als Theoretischer Urteilung, denn in der praktischen Urteilung setzt es sich dem Nichtich, nicht sich selbst entgegen.
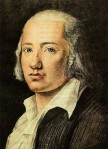 Wirklichkeit
und Möglichkeit ist unterschieden, wie mittelbares und unmittelbares
Bewußtsein. Wenn ich einen Gegenstand als möglich denke, so wiederhol
ich nur das vorhergegangene Bewußtsein, kraft dessen er wirklich ist. Es
gibt für uns keine denkbare Möglichkeit, die nicht Wirklichkeit war.
Deswegen gilt der Begriff der Möglichkeit auch gar nicht von den
Gegenständen der Vernunft, weil sie niemals als das, was sie sein
sollen, im Bewußtsein vorkommen,
sondern nur der Begriff der Notwendigkeit. Der Begriff der Möglichkeit
gilt von den Gegenständen des Verstandes, der der Wirklichkeit von den
Gegenständen der Wahrnehmung und Anschauung.
Wirklichkeit
und Möglichkeit ist unterschieden, wie mittelbares und unmittelbares
Bewußtsein. Wenn ich einen Gegenstand als möglich denke, so wiederhol
ich nur das vorhergegangene Bewußtsein, kraft dessen er wirklich ist. Es
gibt für uns keine denkbare Möglichkeit, die nicht Wirklichkeit war.
Deswegen gilt der Begriff der Möglichkeit auch gar nicht von den
Gegenständen der Vernunft, weil sie niemals als das, was sie sein
sollen, im Bewußtsein vorkommen,
sondern nur der Begriff der Notwendigkeit. Der Begriff der Möglichkeit
gilt von den Gegenständen des Verstandes, der der Wirklichkeit von den
Gegenständen der Wahrnehmung und Anschauung.Wo Subjekt und Objekt schlechthin, nicht nur zum Teil vereiniget ist, mithin so vereiniget, daß gar keine Teilung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen, da und sonst nirgends kann von einem Sein schlechthin die Rede sein, wie es bei der intellektualen Anschauung der Fall ist.

Aber
dieses Sein muß nicht mit der Identität verwechselt werden. Wenn ich
sage: Ich bin Ich, so ist das Subjekt (Ich) und das Objekt (Ich) nicht
so vereiniget, daß gar keine Trennung vorgenommen werden
kann, ohne, das
Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen; im Gegenteil
das Ich ist nur durch diese Trennung des Ichs vom Ich möglich. Wie kann
ich sagen: Ich! ohne Selbstbewußtsein?
Wie ist aber Selbstbewußtsein möglich? Dadurch daß ich mich mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im entgegengesetzten als dasselbe erkenne. Aber inwieferne als dasselbe? Ich kann, ich muß so fragen; denn in einer andern Rücksicht ist es sich entgegengesetzt Also ist die Identität keine Vereinigung des Objekts und Subjekts, die schlechthin stattfände, also ist die Identität nicht = dem absoluten Sein
aus: Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Frankfurt a. M. 1961, S. 547f.
Wie ist aber Selbstbewußtsein möglich? Dadurch daß ich mich mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im entgegengesetzten als dasselbe erkenne. Aber inwieferne als dasselbe? Ich kann, ich muß so fragen; denn in einer andern Rücksicht ist es sich entgegengesetzt Also ist die Identität keine Vereinigung des Objekts und Subjekts, die schlechthin stattfände, also ist die Identität nicht = dem absoluten Sein
aus: Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Frankfurt a. M. 1961, S. 547f.
Nota. - Die drei Zimmergenossen Hölderlin, Schelling und Hegel hatten sich schon in ihrer Zeit im Tübinger Stift mit den neuesten Entwicklungen der Kant'schen Kritischen Philosophie beschäftigt, namentlich mit Carl Leonhard Reinhold, dem Vorgänger Fichtes auf dem Jenaer Lehrstuhl und Vorreiter des radikalen Flügel der damaligen Kant-Partei. Das Erscheinen von Fichtes Begriff der Wissenschaftslehre 1794 versetzte sie in Erre- gung, und Hölderlin ging im folgenden Jahr nach Jena, um Fichtes Vorlesungen zur Wissenschaftslehre zu hören.
Fichtes Lehre sei, schreibt Egon Friedell,* "eine radikale Künstlerphilosophie. Und die Romantiker verstanden sie und machten Fichte zu ihrem Propheten". Auf Fichtes Vortrag nimmt der obige Aufsatz aus dem Frühjahr 1795 unmittelbar Bezug, doch das Verständnis erscheint in einem eignen Licht.
Damit, dass die Identität von Subjekt und Objekt mit dem aboluten Sein nicht 'identisch' sei, hat Hölderlin wohl Recht. Das Ich der intellektuellen Anschauung 'ist' keineswegs absolut; es 'ist' lediglich im actus der intellektuellen Anschauung, nicht vorher, nicht nachher. Es 'ist' Noumenon und wird im besten Fall Idee, als Postulat. Das wäre Hölderlin offfenbar nicht genug. Er will ein absolutes Sein - was er in der Transzendentalphilophie freilich nie- mals würde finden können.
Fichtes Lehre sei, schreibt Egon Friedell,* "eine radikale Künstlerphilosophie. Und die Romantiker verstanden sie und machten Fichte zu ihrem Propheten". Auf Fichtes Vortrag nimmt der obige Aufsatz aus dem Frühjahr 1795 unmittelbar Bezug, doch das Verständnis erscheint in einem eignen Licht.
Damit, dass die Identität von Subjekt und Objekt mit dem aboluten Sein nicht 'identisch' sei, hat Hölderlin wohl Recht. Das Ich der intellektuellen Anschauung 'ist' keineswegs absolut; es 'ist' lediglich im actus der intellektuellen Anschauung, nicht vorher, nicht nachher. Es 'ist' Noumenon und wird im besten Fall Idee, als Postulat. Das wäre Hölderlin offfenbar nicht genug. Er will ein absolutes Sein - was er in der Transzendentalphilophie freilich nie- mals würde finden können.
Was Transzendentalphilosophie bedeutet, verstanden sie mehr intuitiv, in der Vorstellung, als rationell - nach Begriffen. Dass es eine intelligible Welt im Modus des Als-ob gäbe, an deren Maßstab das Wirkliche blass und dürftig wirkt, war ihnen als Künstlern ein Apriori und gewissermaßen ihre Existenzgrundlage. Aber die roman- tische Weltauffassung liebäugelt mit der Möglichkeit, im Als-ob zu leben; das reale Individuum im Alltag mit dem transzendentalen Subjekt zum Absoluten Ich zu vereinen.
Das ist keinem von ihnen gelungen, Friedrich Schlegel wird zum Agenten Metternichs und zum Spitzel des Vatikans, Novalis verliert den Verstand und stirbt seiner zwölfjährigen Verlobten nach, Brentano wird zum frommen Schwärmer; und Hölderlin verbringt den Rest seines Lebens im Turm überm Neckar.
Der
einzige Romantiker, der den Versuch durchgehalten hat, indem er den
Zwiespalt zu seinem täglich' Brot machte, war der Berliner
Amtsgerichtsrat Hoffmann. Na ja, es war wohl doch eher ein täglich' Rausch.
Nachtrag. - Wo bei Hölderlin der transzendentale Standpunkt
doch irgendwie erhalten bliebe, kann ich nicht sagen, so gut kenne ich
mich in der schönen Literatur nicht aus. Bei den Jenaer Romantikern ist
es jedenfalls die Ironie, von der Hölderlin ganz frei ist (sofern man nicht die Gedichte aus dem Turm darunter fasst). In ihr er- scheint das Einereseits-andererseits und Sowohl-als-auch als lebenspraktische Einheit, Ironie ist der Modus des Künstlerlebens. Und ob man diesen Standpunkt durchhalten kann, ist daher ebenfalls eine lebenspraktische Frage; siehe oben.
JE, 13. 3. 18
...Wie sollte nicht jeder Satz über das Absolute und Transzendente nur unter ironischem Vorbehalt gesprochen werden dürfen? Endliches zu sagen über das Unendliche kann und darf nur ironisch sein. Ironie gehört deshalb in jede Philosophie, die das Ganze zu begreifen versucht... "Ist sie nicht wirklich die innerste Mysterie der kritischen Philosophie?" Rüdiger Safranski, Romantik, eine deutsche Affäre, München 2007, S.
"...
...Wie sollte nicht jeder Satz über das Absolute und Transzendente nur unter ironischem Vorbehalt gesprochen werden dürfen? Endliches zu sagen über das Unendliche kann und darf nur ironisch sein. Ironie gehört deshalb in jede Philosophie, die das Ganze zu begreifen versucht... "Ist sie nicht wirklich die innerste Mysterie der kritischen Philosophie?" Rüdiger Safranski, Romantik, eine deutsche Affäre, München 2007, S.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen