
aus spektrum.de, 21. 10. 2021 zu Jochen Ebmeiers Realien
Die Psychologie des menschlichen Geistes
Wie
lässt sich Bewusstsein erklären? Der ehemalige Direktor der
Max-Plack-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften widmet sich
in seinem neuen Buch dieser anspruchsvollen Aufgabe.
Eines
vorneweg: Das Buch lohnt sich. Wolfgang Prinz, emeritierter Direktor
des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in
Leipzig, entwickelt auf 300 Seiten Ansätze und Ideen, um die Erklärung
menschlichen Bewusstseins voranzu-bringen. Er will damit nachholen, was
die Psychologie in seinen Augen bisher versäumt hat: Bewusstsein mittels
psychologischer Theorien begreiflich machen.
Tief gehende Auseinandersetzung mit dem menschlichen Geist
Das
Werk ist in drei große Abschnitte aufgeteilt. Im ersten setzt sich der
Autor mit der Psychologie als wissenschaftlicher Disziplin auseinander
und attestiert ihr zunächst nicht nur mangelnde Kompaktheit, sondern
auch fehlendes 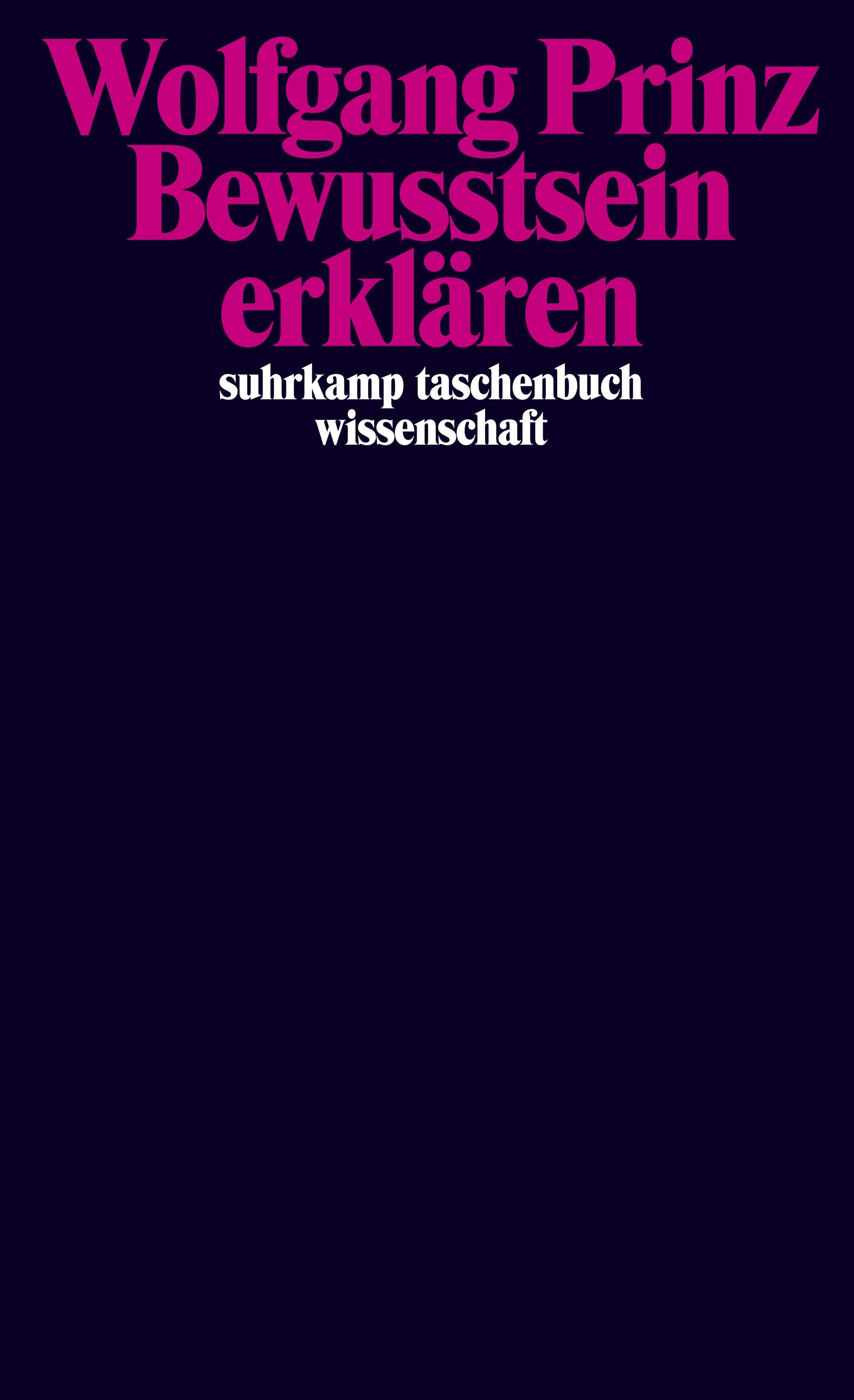 Selbstbe-wusstsein. Fundiert legt er dar, was die
Disziplin leisten kann und muss – oder eben nicht, wenn es um die
Erklärung von Bewusst-sein geht.
Selbstbe-wusstsein. Fundiert legt er dar, was die
Disziplin leisten kann und muss – oder eben nicht, wenn es um die
Erklärung von Bewusst-sein geht.
Im Rahmen eines
Gedankenexperiments erweitert Prinz das bisherige Konzept der
Reprä-sentation zur Selbstrepräsentation. Während primäre
Steuerungssysteme die Umwelt abbilden, wird die Beziehung zwischen
Primärsystem und Umwelt durch sekundäre Steuerungssysteme repräsentiert.
Selbstrepräsentation könne somit das widerspiegeln, was Subjektivität
als zentrales Kennzeichen bewussten Erlebens in der intentionalen
Beziehung zwischen Inhalt, Akt und Subjekt beinhaltet.
Im
zweiten Abschnitt des Buchs diskutiert Prinz, wie die
Sekundärsteuermechanismen entstehen könnten. Zunächst unterscheidet er
implizite und explizite Repräsentationen. Letztere gründen auf ersteren
und sind daher deutlich komplexer. Während implizite Repräsentationen
eine effiziente Handlungssteuerung ausreichend erklären, so Prinz,
integrieren explizite Repräsentationen sowohl Informationen über Dinge
als auch über das System, das sie darstellt. In anderen Worten:
Repräsentiert wird nicht nur das, was ein Individuum über die Welt weiß,
sondern auch, von wem und in welcher Form dieses Wissen besessen wird.
Das sei nicht nur die Grundvoraussetzung für bewusstes Erleben, sondern
auch, um zwischenmenschliche Interaktionen und Kommunikation zu
ermöglichen.
Darüber hinaus erläutert Prinz, wie Subjektivität und
Bewusstsein durch soziale Spiegelpro-zesse entstehen könnten: »Menschen
werden dadurch zu bewusst wahrnehmenden und denkenden Subjekten, dass
sie sich zu eigen machen, was sie anderen zuschreiben, und dass sie
wahrnehmen, was andere ihnen zuschreiben.« In den folgenden Kapiteln
erörtert der Autor, wie Subjektivität und Bewusstsein von sozialen
Praktiken und Diskursen abhängt und durch sie geformt wird. Dabei
diskutiert er auch, inwiefern Tiere und Maschinen über Bewusstsein
verfügen können.
Im
letzten Abschnitt wendet sich Prinz zunächst der Frage zu, wie real
Bewusstsein ist, wenn es sich schlussendlich bloß um ein soziales
Artefakt handle. Der Autor ist überzeugt, ein Illusionsverdacht könne
ausgeräumt werden. Selbst wenn Subjekte sozial gemacht sind, gibt es sie
wirklich. Und wie steht es um den freien Willen? Dass sich Psychologen
zu dieser Thematik äußern, hält Prinz für in etwa so notwendig wie den
Vortrag eines Zoologen zu Einhörnern. Denn aus psychologischer
Perspektive sei die Freiheit des Willens zu leugnen. Das intuitive
Erleben subjektiver Freiheit lasse sich allerdings aus der Rolle des
mentalen Selbst heraus erklären. Demnach habe der Mensch zwar von Natur
aus keinen freien Willen, könne ihn sich aber durch Zuschreibungen zu
eigen machen. Wegen der damit einhergehenden positiven sozialen
Implikationen, etwa Verantwortlichkeit, ist dies aus Sicht des Autors zu
begrüßen.
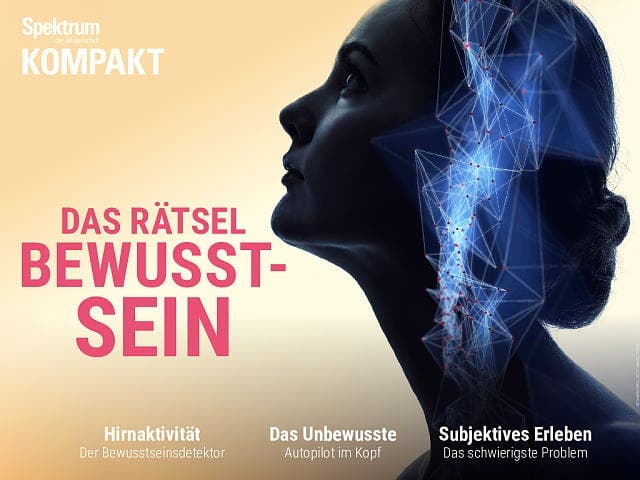
Wem die beschriebenen Inhalte bekannt erscheinen, irrt nicht.
Bis auf die vergleichsweise kurzen Kapitel 11 und 12 beruhen die
Ausführungen von Prinz auf bereits veröffentlichten Beiträgen aus den
letzten 25 Jahren. Dass die für das vorliegende Werk überarbeiteten und
zusammengeführten Beiträge »Spuren ihrer Herkunft« enthalten, gesteht
Prinz gleich zu Beginn ein. Die zusätzliche inhaltliche Tiefe und Dichte
seiner Ausführungen sowie eine komplexe Gedankenführung machen die
Lektüre nicht immer einfach. Wer sich aber darauf einlässt, darf einen
intellektuellen Lese- und Erkenntnisgenuss erwarten.
Nota. - Das ist löblich, dass ein Vertreter einer realen und empirischen Wissenschaft daran macht, 'Bewusstsein' und 'Ich' mit den Mitteln seiner Disziplin, der Psychologie, zu be-schreiben, ohne dabei auf Schritt und Tritt im begrifflichen Arsenal der Philosophie zu wildern, das dazu nicht taugt und dafür nicht gedacht war.
Die eine erklärt, soweit es ihr gelingt, was das Ich und was sein Bewusstsein ist; die andere beansprucht, einen Sinn darin aufzufinden - oder richtiger: hineinzufinden. Nur, wenn sie alle Erwägungen, die über das Faktische hinausweisen, aus ihren Untersuchung fernhalten, kann eine Wissenschaft wirklich positiv und empirisch sein: Die Frage nach einem Natur-zweck gehört nicht in die Wissenschaft, sondern höchstens in die Religion. Und nur, wenn jene begreift, dass sie in geprüfte Fakten einen Sinn hineindeuten muss und nicht in eine gefällige Auswahl, darf sie das Spekulieren überhaupt beginnen.
Will sagen: Die Trennung ist die wissenschaftliche Bedingung für beide - und bleibt es bis zum Schluss. Einen "Übergang" kann es nicht geben und braucht es nicht zu geben, und schon, wer danach sucht, bewegt sich auf abschüssiger Bahn.
Ein Problem ergibt sich freilich nicht auf der spekulativen, sondern auf der empirischen Seite. Empirische Forschung beruht auf dem Kausalitätsprinzip: Was immer geschieht, hat eine hinreichende Ursache.
Die ist beim Bewusstein ja eben fraglich. Irgendeine Ursache muss es geben, doch die al-lerletzte oder allererste kann es nicht sein, denn die wäre - ohne Ursache. Ein experimentell nicht nachweisliches X, ein irgendwie latentes Vor-Ich muss auch der Empiriker annehmen, obwohl er es im Ernst gar nicht darf. Er kann den Philosophen nur beneiden.
JE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen